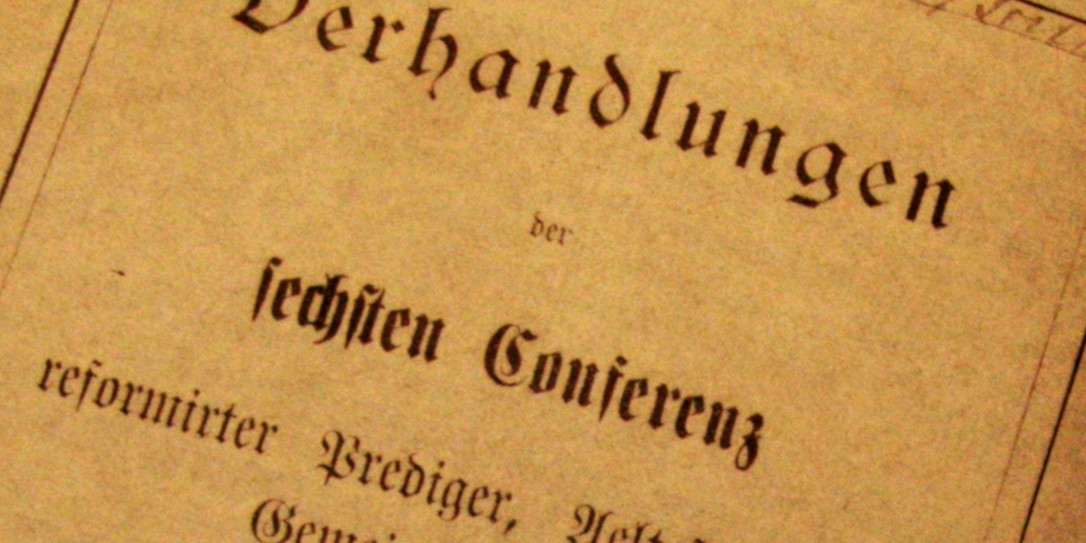Wichtige Marksteine
Reformierte im Spiegel der Zeit
Geschichte des Reformierten Bunds
Geschichte der Gemeinden
Geschichte der Regionen
Geschichte der Kirchen
Biografien A bis Z
(1528–1572)
Jeanne d´Albret (1528–1572) war die bedeutendste Frau in der Geschichte der Hugenotten im 16. Jahrhundert. Besonders in ihrem Witwenstand, in den letzten zehn Jahren ihres Lebens, baute sie eine reformierte Kirche in Béarn auf und war das politische Oberhaupt der Hugenotten im dritten Religionskrieg (1568–1570). Nach 1570 versuchte sie, die Reformierten zu schützen und ihnen einen gesicherten Platz in der Gesellschaft zu verschaffen. Sie handelte für die Hugenotten den Friedensschluss von St. Germain 1570 aus, und durch die Heirat ihres Sohnes Heinrich (später Heinrich IV. von Frankreich) mit Margarete von Valois, Schwester des Königs Karl IX. von Frankreich, strebte sie eine enge Verbindung von Hugenotten und Katholiken an.
Keine andere Frau hatte eine solche Machtposition unter den Hugenotten in Frankreich inne. Sie war respektiert und gefürchtet in Rom und Madrid, alliiert mit Elizabeth von England und befreundet mit Katharina von Medici – keine unkomplizierte Freundschaft zwischen zwei starke Frauen.
Sie sorgte dafür, dass ihre Kinder – Heinrich und Katharina – im reformierten Glauben erzogen wurden. Jahrelang kämpfte Heinrich als Anführer der Hugenotten und von einer Machtbasis in Südfrankreich aus um die französische Krone, bis er 1589 König von Frankreich wurde und schließlich 1593 zum katholischen Glauben übertrat, um das Land zu befrieden.
Jeanne d´Albret war nicht nur Mutter ihres berühmten Sohnes, sie war auch selbst eine machtvolle Frau in Frankreich, da ihre Position als Anführerin der Hugenotten ihr einen Einfluss weit über die Grenzen ihres kleinen Königreiches zusicherte.
Jugend und Ehe (1528-1555)
Jeanne d´Albret wurde am 7. November 1528 auf dem Schloss Blois von Margarete und Heinrich II. von Navarra geboren. Ihre Mutter wusste angeblich, dass sie eine Tochter gebären würde, ihr sehnlichster Wunsch war freilich nach einem Sohn. Jeanne blieb das einzige Kind aus dieser Ehe, Margarete von Navarra gebar zwar kurz danach einen Sohn, der als Kleinkind starb, und alle übrigen Hoffnungen auf Schwangerschaften zerschlugen sich.
Die kleine Prinzessin konnte von ihrem Vater das Königreich Navarra erben, weil dort das salische Gesetz, das in Frankreich weibliche Thronerben verbot, nicht gültig war. Außerdem war das vicomté Béarn selbständig. Deswegen waren die zwei Großmächte Spanien und Frankreich zutiefst an diesen Grenzregionen interessiert. Frankreich wollte seine Südgrenze verteidigen, und Spanien beide Seiten der Pyrenäen besitzen, um in Frankreich einfallen zu können. Zudem war die väterliche Familie von Albret Großgrundbesitzer in Südwestfrankreich und damit Vasall des französischen Königs. Das frühere Aquitanien hatte mehrere hundert Jahre der englischen Krone gehört und war spät von England aufgegeben worden. Im 16. Jahrhundert wurde das Gebiet meistens als Guyenne bezeichnet.
In ihren jungen Jahren wuchs Jeanne in der Normandie auf. Ihre Mutter, Margarete von Navarra, hatte die Aufgabe, die königlichen Kinder ihres Bruders, Franz I., zu erziehen. Sie gab Jeanne in die Obhut ihrer Freundin Aymée de Lafayette, Vogtin von Caen. Man behauptet, sie sei die Vorlage für die Figur Longarine in Heptameron (vgl. Nielsen). Nach meiner Auffassung sind die Erzähler/innen im Heptameron, die sogenannten devisants, eher Typen als historische Persönlichkeiten, die Figur der Longarine ist allerdings eine sehr sympathische Frau mit Humor und Pfiff. Wenn Aymée de Lafayette die Vorlage zu Longarine abgegeben haben soll, deutet alles darauf hin, dass Margarete sie sehr schätzte und meinte, ihre Tochter sei bei ihr gut aufgehoben.
Jeanne wuchs in einem landadligen Milieu auf, umgeben von Wald, Wiesen und Tieren, mit den Mitgliedern der Familie von Aymée de Lafayette als Bezugspersonen, bis sie zehn Jahre alt war. Ihre Mutter sah sie selten, aber jedes Mal, wenn sie krank war, war Margarete sofort zur Stelle. 1538 ließ Franz I. sie nach Plessis-lez-Tours bei der Loire übersiedeln, da sie jetzt ein Alter erreicht hatte, wo sie auf dem Heiratsmarkt von Interesse war. Der König konnte über seine Verwandte entscheiden und Ehen arrangieren, wie es ihm passte.
1540 war es für Jeanne so weit. Herzog Wilhelm der Reiche von Kleve-Jülich-Berg hatte 1538 das Herzogtum Geldern geerbt. Sein Erbanspruch wurde von Kaiser Karl V. angefochten und auf dem Reichstag zu Regensburg wurde dem Kaiser Geldern zugeteilt. 1539 folgte Wilhelm seinem Vater auf dem Thron nach, und um sich vor den Ansprüchen des Kaisers zu schützen, arrangierte er eine Ehe mit Heinrich VIII. von England für seine Schwester Anna, und selbst verbündete er sich mit Franz I. Als Unterpfand für dieses Bündnis sollte er Jeanne d´Albret heiraten.
Was jetzt passierte, ist absolut ungewöhnlich: Jeanne weigerte sich. Die Zwölfjährige ließ ihrem Onkel wissen, dass sie den Herzog nicht heiraten möchte, und sie ließ zwei Schreiben aufsetzen, in welchen sie erklärte, dass sie gegen ihren Willen zu dieser Ehe gezwungen worden sei. Natürlich konnte sie sich nicht auf Dauer gegen den Willen des Königs auflehnen, aber bei der Hochzeitszeremonie am 14. Juni 1541 weigerte sie sich, zum Altar zu schreiten, stattdessen musste sie getragen werden. Ihr Jawort war nicht hörbar und wegen ihres Alters wurde die Ehe nicht vollzogen, der Herzog setzte nur symbolisch ein Bein in ihr Bett. Nach der Hochzeit kehrte er zurück nach Düsseldorf, während Jeanne vorläufig in Frankreich blieb.
1543 griff Kaiser Karl Kleve-Jülich-Berg an, der Herzog wurde geschlagen und musste Geldern Karl V. überlassen. Am Frieden von Venlo im September 1543 hob er das Bündnis mit Franz I. auf und verbündete sich stattdessen mit dem Kaiser. Damit war auch die französische Ehe hinfällig geworden, 1545 wurde sie vom Papst wegen Nichtvollzug annulliert, und der Herzog vermählte sich mit einer Nichte des Kaisers.
Nach kanonischem Recht durfte bei einer Eheschließung keine Zwang im Spiel sei. Die Eheleute mussten ihr Gelübde frei abgeben. Damals konnten junge Frauen aus adligen oder königlichen Familien sich ihre Ehepartner nicht selbst aussuchen, sondern wurden als politische Garanten vermählt, und die meisten fanden sich damit ab, weil das ihr Standesbild entsprach. Jeannes Ablehnung, so wie ihre Kenntnis des kanonischen Rechts, ist erklärungsbedürftig.
Eine mögliche Erklärung ist, dass ihre Eltern für sie eine Ehe mit dem Kronprinzen Philipp von Spanien anstrebten. Königin von Spanien war natürlich prestigeträchtiger als Herzogin von Kleve zu sein, aber vor allem erhoffte sich ihr Vater damit den spanischen Teil von Navarra zurückzugewinnen. 1512 hatten die Spanier Navarra, das Baskenland, bis zu den Pyrenäen erobert und den Albrets nur das winzige Gebiet auf der französischen Seite gelassen. Seitdem überlegten sich die Könige von Navarra, wie sie zu ihrem ganzen Erbe kommen konnten, und eine Ehe zwischen dem Infanten von Spanien und der zukünftigen Königin von Navarra würde genau dies herbeiführen.
Jeanne war möglicherweise auch beeinflusst von einer Erklärung der Ständeversammlung von Béarn, die eine auswärtige Ehe für ihre Kronprinzessin ablehnte.
Sah Jeanne d´Albret ihre Zukunft gefährdet durch eine Ehe mit dem Herzog von Kleve? Oder tat sie, was ihre Eltern wünschten, statt des Königs Willen zu erfüllen? Stammten ihre Kenntnisse des kanonischen Rechts von denen? Margareta von Navarra schrieb ihrem Bruder, sie habe keine Ahnung, was in das Mädchen gefahren sei, aber stimmt das? Hat sie Jeanne mit ihrer Ablehnung der Ehe geholfen aus Liebe (Cholakian & Cholakian), oder aus Ehrgeiz? Es besteht kein Zweifel, dass königliche Kinder damals frühreif waren und in jungen Jahren schon an ihre späteren Aufgaben geführt wurden, trotzdem ist die Zähigkeit und Sturheit des Mädchens erstaunlich.
1547 starb Franz I. und als Jeanne zwanzig Jahre alt war, bot der Nachfolger, Heinrich II. von Frankreich, ihr gleich zwei Heiratskandidaten an: den Herzog Franz von Aumale (der spätere erzkatholische Herzog Franz von Guise) und Anton von Bourbon, Herzog von Vendôme. Der letztere war Erbprinz und vielleicht deshalb für Jeanne die bessere Partie, obwohl er relativ arm war. Er war hochgewachsen – was für einen Bourbon eher selten war – und charmant, wie alle Männer in seiner Familie scheint er ein unverbesserlicher Schürzenjäger gewesen zu sein. Heinrich IV. von Frankreich, der vert galant, hatte seine ausgelebte Sexualität nicht von Fremden, ebenso wenig wie sein militärisches Können und seinen Mut.
Jeanne und Anton von Bourbon heirateten 1548 und sie war überglücklich. Heinrich II. schrieb in einem Brief, dass er selten eine Braut erlebt habe, die immer nur lachte. Diese Ehe war aus Liebe geschlossen, und Anton von Bourbon nahm seine Frau mit, als er in den Krieg zog. Der Kriegsschauplatz war Flandern, und da der Herzog Güter in Nordfrankreich besaß, zog Jeanne in den ersten Jahren ihrer Ehe von Schloss zu Schloss, immer in der Hoffnung, dass sie und Anton von Bourbon sich treffen könnten.
1551 gebar sie ihren ersten Sohn und gab ihn an Aymée de Lafayette, die sie selbst erzogen hatte. Ob nun Frau de Lafayette alt oder übervorsichtig geworden war, der kleine Herzog von Beaumont starb als Kleinkind, angeblich weil er von Wärme erstickt worden sei.
Bald wurde Jeanne wieder schwanger, und während ihr ältester Sohn in Nordfrankreich geboren war, sollte das zweite Kind in Béarn zu Welt kommen. Sie unternahm die lange Reise nach Süden und kam gerade rechtzeitig in Pau an, 14 Tage bevor sie von ihrem zweiten Sohn, Heinrich, auf dem Schloss in Pau entbunden wurde. Es wurde entschieden, dass dieser Junge in Pau bleiben sollte. Der Großvater, Heinrich d´Albret, wollte wahrscheinlich mit diesem kleinen Prinzen die Erbfolge in Béarn und Navarra sichern. Die Legenden von der rauen Erziehung Heinrichs seitens des Großvaters können jedoch nicht wahr sein, allein weil das Kind die ersten Jahre von Ammen betreut wurde, und der Großvater starb, als es zwei Jahre alt war. Es scheint in Béarn Sitte gewesen zu sein, die Lippen des Täuflings mit Rotwein und Knoblauch einzureiben, eine Taufe à la Gascogne, aber die Mär, dass Heinrich barfuß unter den Hirten in den Bergen aufgewachsen sein soll, ist reine Legende. Der spätere Hauslehrer Heinrichs, Palma Cayet, schrieb, als Heinrich schon König von Frankreich war, seine Biographie, und daher stammt der Bericht vom Opa und von seiner rauen Erziehung. Dieser Kindheitsbericht ist eher Propaganda des Königs, wie er gerne gesehen werden möchte.
Tatsächlich kam Heinrich in die Obhut der Familie de Miossens, die auf dem Schloss Coarraze wohnte. Die Frau, Suzanne de Bourbon-Miossens, war eine Cousine von Jeanne. Heinrich wurde demnach genau wie seine Mutter als Landadliger erzogen, und er wuchs in einer Familie mit anderen Söhnen auf, die als Erwachsene seine Gefolgsleute werden sollten. Als seine Mutter den Thron erbte, wurde er schon als Kleinkind als Kronprinz behandelt.
Die zwei Jahre zwischen Heinrichs Geburt 1553 und ihre Thronbesteigung 1555 verbrachte Jeanne wiederum in Nordfrankreich in der Nähe ihres Gatten. In dieser Zeit gebar sie einen dritten Jungen, der jedoch nicht lange lebte. Es muss hinzugefügt werden, dass Anton von Bourbon 1554 einen außerehelichen Sohn, Karl von Bourbon, mit einer Hofdame bekam. Jeanne hatte bereits mehrere Onkel, die illegitim waren, und sie scheint den kleinen Karl in ihrer Familie aufgenommen zu haben. Er wurde später Erzbischof von Rouen.
Erst als der Vater gestorben war, zog sie als Königin nach Pau und obwohl sie die Erbin war, ließ sich ihr Mann als König huldigen, was die Ständeversammlung eigentlich gar nicht wollte, dennoch ordneten sie sich dem Willen Jeannes unter.
Königin an der Seite von Anton von Bourbon (1555–1560)
Ihr Vater hatte Jeanne ein blühendes Land hinterlassen. Er hatte Industrien nach Béarn geholt, das Steuersystem effektiv gestaltet und für den religiösen Frieden gesorgt. Große Einkünfte entstanden auch durch seine Posten als Gouverneur und Admiral der französischen Krone in Guyenne. Anton von Bourbon bekam diese Posten nach seinem verstorbenen Schwiegervater, und später hat sein Sohn, Heinrich von Navarra, sie übernommen. Jeanne und Antoine standen als die größten Grundbesitzer Südwestfrankreichs finanziell sehr gut da.
1555 find Calvin seine missionarische Tätigkeit in Frankreich an. Reformierte gab es in Südwestfrankreich zu diesem Zeitpunkt längst, weil Margareta von Navarra sie mit Predigern unterstützt hatte und Gérard Roussel, einen Reformkatholiken, als Bischof in Orthez, eingesetzt hatte. Dieser Roussel war einmal Weggefährte Calvins gewesen, und dieser warf ihm vor, nicht konsequent genug zu sein, als er die Stelle als katholischer Bischof trotz seiner reformatorischen Sympathien annahm (CStA I,1).
Als Königin hatte Jeanne bei ihrer Krönung versprechen müssen, die katholische Religion zu verteidigen. Am selben Tag, nachdem sie diesen feierlichen Eid abgelegt hatte, schrieb sie an einen Vasallen, dem vicomte von Gourdon, und erzählte ihm, sie wolle über die Förderung des reformierten Glaubens im kleinem Kreis heimlich beraten. Dieser Brief ist Teil eines Briefwechsels mit zwei vicomtes de Gourdon, Vater und Sohn, die die gesamte Regierungszeit Jeannes überdauerte. Die Briefsammlung wurde im vorigen Jahrhundert entdeckt und gibt viele neue Einsichten in die Vorhaben und die Beweggründe Jeannes. Da die entdeckten Briefe uns nur als teilweise fehlerhafte Kopien vorliegen, haben viele Forscher die Briefe als Fälschungen abgetan (Text und Diskussion bei Bryson).
Der erste Brief vom August 1555 teilt uns mit, dass Jeanne schon zu diesem Zeitpunkt reformierte Sympathien deutlich aussprach. Sie schrieb dem vicomte, dass ihre Mutter sich zwischen den zwei Religionen nicht habe entscheiden können, und dass sie selbst aus Furcht vor ihrem Vater bislang nicht gewagt habe, sich offen zum Protestantismus zu bekennen. Das Edikt von Chateaubriant von 1551 verbot eindeutig jede „Ketzerei“ und deshalb schlug sie vor, die Reformierten sollten sich heimlich auf dem Schloss Odos treffen.
Es gibt sonst keine Quellen, die belegen könnten, dass Jeanne mit dem reformierten Glauben in Berührung kam. Es gab in ganz Frankreich zu der Zeit kleine zerstreute Gemeinden, sowie Prediger und Kolporteure, die reformatorische Bücher schmuggelten. Die wiederholten Verbote des Königs konnten das nicht unterbinden, sie führten nur dazu, dass Protestanten, wie Jeanne, sich heimlich treffen mussten.
In den Jahren nach 1555 verbreitete sich der reformierte Glaube mehr und mehr im Hochadel. Auch Anton von Bourbon wurde davon ergriffen, brachte reformierte Prediger nach Béarn und als er und Jeanne 1558 mit Heinrich nach Paris zogen, nahm er an großen psalmensingenden Demonstrationen außerhalb der Stadtmauern von Paris teil. Calvin war darüber hoch erfreut, denn er setzte in seiner Missionsarbeit gerne auf hochrangige Persönlichkeiten. Jeanne dagegen verhielt sich während dieser Zeit bedeckt.
In Paris kam sie mit ihrem vierten Kind, einer Tochter namens Katharina, nieder. Das kleine Mädchen war das einzige Kind, das bei Jeanne aufwachsen durfte, obwohl sie (natürlich) Erzieherinnen und Gouvernanten hatte.
Anton von Bourbon fiel nicht nur mit protestantischen Sympathien auf, sondern wie sein Schwiegervater versuchte er, den spanischen Teil von Navarra zurückzugewinnen. Heinrich d´Albret hatte seinen Besitz gut und gewinnbringend regiert, während Anton von Bourbon seiner Frau die Regierungsgeschäfte überließ, und selbst nur versuchte, ein größeres Königsreich für sich zu gewinnen. So konnte der spanische König Philipp ihm einen Tausch, erst mit dem Herzogtum Milano und später mit Sardinien, anbieten. Damit hätte Spanien den Sprung über die Pyrenäen geschafft und Südfrankreich bedrohen können. Wir würden solches Taktieren mit dem Feind Hochverrat nennen, damals räumte man freilich Adligen große Freiheiten ein, sich einen Herren auszusuchen, aber Anton von Bourbon wurde auch von den Zeitgenossen als unzuverlässig und unverantwortlich angesehen, und nicht zuletzt war er so politisch ungeschickt, dass es an Dummheit grenzte (Sutherland 1984).
Im Sommer 1559 starb Heinrich II. von Frankreich unerwartet. Sein Sohn Franz II. folgte ihm als nur fünfzehnjähriger Knabe auf dem Thron. In dieser Situation war die traditionelle Lösung, dass der erste erwachsene Erbprinz, Anton von Bourbon, ihn unterstützen sollte, und Calvin ermahnte ihn eindringlich, dieses Amt zu übernehmen und dabei den Hugenotten zu helfen. Anton von Bourbon verspielte diese Chance und überließ die Regierungsgeschäfte der Familie von Guise, besonders dem Herzog von Guise und dem Kardinal von Lorraine, die beide die antiketzerische Politik des verstorbenen Königs weiterführen wollten. Nach dem Tod Heinrichs II. bekannten sich mehrere hochrangige Adlige offen zum Protestantismus und es gab im März 1560 sogar einen hugenottischen Komplott, den König zu entführen und von seinen „schlechten Ratgebern“ zu trennen. Anton von Bourbon und sein jüngerer Bruder, der Prinz von Condé, beide notorische Reformierte, wurden wegen diesem Angriff auf den König angeklagt. Anton von Bourbon versprach Besserung, während sein Bruder, der Prinz Ludwig von Condé zum Tode verurteilt wurde. Nur der plötzliche Tod des jungen Königs rettete ihn vor der Hinrichtung. Da der neue König, Karl IX., ein zehnjähriges Kind war, brauchte Frankreich einen Regenten, nämlich den ranghöchsten Erbprinz Anton von Bourbon. Wiederum ergriff dieser nicht die Chance. Katharina von Medici ließ sich stattdessen als Regentin einsetzen und Anton von Bourbon wurde zum Generalstatthalter ernannt. Die Hugenotten mit Calvin an der Spitze waren zutiefst enttäuscht. In diesen Jahren hatte der reformierte Glaube großen Zulauf, es wurde von mehreren Tausend Gottesdienstbesuchern überall in Frankreich berichtet, von Abendmahlgottesdiensten, die zwei Tage dauerten und von Bekehrungen am Hof und im Hochadel.
1560 verließ Jeanne Paris, um zurück nach Pau zu fahren. Theodorus Beza, der engste Mitarbeiter Calvins, besuchte sie dort, und es entwickelte sich eine enge Zusammenarbeit, die bis Jeannes Tod dauerte. Beza versorgte sie mit Predigern und Beratern für ihr Land. Im Dezember 1560 unternahm Jeanne den entscheidenden Schritt und bekehrte sich öffentlich zum reformierten Glauben. Während ihr Gatte nicht in der Lage war, sich an die Spitze der Hugenotten zu setzen, wurde sie jetzt die leitende Hugenottin in Frankreich.
Reformierte Königin (1560–1568)
Jeanne d´Albret war zweifelsohne eine tief religiöse Frau. Lange Zeit hatte sie äußerste Diskretion walten lassen, zwar mit ihrem Gatten reformierte Prediger gehört, aber sich niemals offen zum reformierten Glauben bekannt. Erst nachdem Anton von Bourbon sich mit dem Posten als lieutenant générale abgefunden hatte, kam sie aus der Deckung.
Es war eine Zeit, wo alle große Hoffnungen bzw. Ängste für den Protestantismus in Frankreich hegten. Drei wichtige Katholiken – der Herzog von Guise, der Konstabel von Montmorency und der Marschall St. André – schlossen sich zusammen, um Frankreich gegen die Reformierten zu schützen. Sie planten den Sturz von Anton von Bourbon und einen Angriff auf Genf mit der Hilfe des Herzogs von Savoyen, zu dessen Besitz Genf bis 1534 gehört hatte. Dieses Triumvirat war der erste Vorbote der katholischen Liga, die später Heinrich IV. hartnäckig bekämpfte (Sutherland 1973).
1560 war noch zu erwarten, dass der Protestantismus nach Frankreich gekommen war, um zu bleiben. Jeanne war sich sehr bewusst, welche Gefahren ihr von Spanien, vom Papst und von der mächtigen Familie von Guise drohten. Sie hatte noch die Hoffnung, dass der junge König Karl IX., Katharina von Medici und ihr Kanzler, der tolerante Michel de l´Hôpital, die Reformierten unterstützen würden, zumal die Königinmutter sich selbst von denen von Guise bedrängt fühlte.
Diese letzte Hoffnung erwies sich als trügerisch, aber niemals wich Jeanne später vom einmal eingeschlagenen Kurs ab. Sie konnte weder geldwerte Vorteile noch politisches Kapital aus ihren Glauben schlagen, dafür hielt sie konsequent an ihrer Überzeugung fest.
In Béarn machte sie erste vorsichtige Schritte, um das Land zu reformieren. Es gab schon Reformierte dort, und Prediger hatten angefangen, den neuen Glauben zu verbreiten, Jeanne aber träumte von einem reformierten Land, und fing langsam und vorsichtig an, diesen Traum zu verwirklichen.
Der erste Schritt war, den reformierten Glauben dem Katholizismus rechtlich gleich zu stellen. Die Kirchen wurden für beide Religionen geöffnet (das sogenannte simultaneum) und aus den Kirchen in Lescar und Pau wurden Bilder und Statuen entfernt, allerdings nicht in Form eines Bildersturms, sondern von den Behörden. Jeanne beschlagnahmte das kirchliche Vermögen nicht für sich selbst, sondern investierte es in Sozialfürsorge und Bildung.
Es ist klar, dass sie den reformierten Glauben einführen wollte, aber zu keinem Zeitpunkt vefolgte sie Andersgläubige, geschweige denn verbrannte sie. Immer setzte sie auf Überredung.
Im August 1561 begab sie sich wieder zum Hof. Überall wurde sie stürmisch von Hugenotten begrüßt, als ob sie „der Messias sei“, bemerkte verärgert der spanische Gesandte. Katharina von Medici hatte zu einem Religionsgespräch eingeladen. Dieses Gespräch fand in Poissy außerhalb Paris statt. Seitens der Krone war gewiss an eine Versöhnung oder gar einen Ausgleich zwischen den Religionen gedacht, die reformierten Teilnehmer mit Beza an der Spitze mochten jedoch keine Kompromisse eingehen. Beza wurde unterstützt von Calvin in Genf, der selbst zu krank war, um mitzukommen. Calvin war mit den Auftritten und Reden Bezas zufrieden, während z.B. der Admiral Coligny Beza als reichlich provokant wahrnahm.
Im Herbst 1562 blieb Jeanne mit ihren Kindern beim Hofe. Katharina von Medici suchte auch nach den Religionsgesprächen eine Übereinkunft mit den Protestanten, was in dem Edikt vom 17. Januar 1562 – auch Edikt von St. Germain genannt – gipfelte. Dieses Edikt, an dem der Kanzler Michel de l´Hôpital und Beza beteiligt waren, erlaubte es den Hugenotten, außerhalb der Städte Gottesdienste zu halten. Es war das günstigste Edikt, das sie jemals erlangen sollten, das Edikt von Nantes 1598 war ihm sehr ähnlich, aber nicht ganz so großzügig. Der Unterschied war, dass Heinrich IV. dafür sorgte, dass das Edikt von Nantes durchgeführt wurde, während alle frühere Edikte, so wohlgemeint sie auf dem Papier auch waren, von katholischen Behörden unterlaufen wurden, und der König zu schwach war, um für ihre Durchführung zu sorgen.
Im März 1562 massakrierte der Herzog von Guise eine reformierte Gemeinde, die innerhalb des Städtchens Wassy Gottesdienst feierte. Damit war die Versöhnungspolitik Katharinas von Medici gescheitert. Die Hugenotten unter dem Prinzen von Condé griffen zu den Waffen und Anton von Bourbon bat Jeanne den Hof zu verlassen. Er behielt seinen Sohn Heinrich bei sich, entließ aber dessen hugenottischen Hauslehrer. Jeanne beschwor ihren Sohn, nicht zur Messe zu gehen, und der junge Prinz hielt sich wohl auch ein paar Wochen daran, musste sich aber schließlich fügen. Nach ihrem Fortgang vom Hofe trat Jeanne eine monatelange abenteuerliche Reise durch Frankreich an, so gefährlich, dass die ersten Briefen von der Hand Heinrichs seine Ängste um seine Mutter bezeugen. Ihre kleine Tochter Katharina durfte sie behalten.
Im ersten Religionskrieg führte Anton von Bourbon die königlichen katholischen Truppen gegen die Hugenotten. Bei der Belagerung von Rouen wurde er verwundet und starb am 17. November. Der junge Heinrich blieb am Hofe in der Obhut Katharinas von Medici, die allerdings Jeanne gestattete, ihm wieder reformierte Hauslehrer zu geben. Sie sollte ihn erst 1564 wiedersehen.
Die Kirche in Béarn und Navarra
Ihre große Aufgabe sah Jeanne darin, die Reformation in Béarn durchzuführen.
Calvin stellte ihr Jean Raymond Merlin zur Seite, den früheren Professor für Hebräisch in Lausanne, wo er Kollege von Beza, dem Professor für Griechisch, und von Pierre Viret, dem Rektor der Akademie, gewesen war. Pierre Viret arbeitete nach seiner Zeit in Lausanne und Genf vor allem in Frankreich, besonders in den Kirchen von Lyons und Nîmes. Später sollte er für Jeanne d´Albret ihre Akademie in Orthez aufbauen. Merlin war übrigens mit einer Tochter von Marie Dentière verheiratet, derjenigen, die vor Jahren Jeanne eine selbstgeschriebene hebräische Grammatik zugesandt hatte (vgl. Graesslé13f.; Nielsen).
Merlin ging voll Eifer an die Aufgabe, eine reformierte Kirche in Béarn aufzubauen. Es gab viele Reformierte in Südfrankreich, aber meistens unter städtischen Eliten und Handwerkern. Die Reformierten waren meistens des Lesens fähig, vor allem des Lesen französischer Texte. In Südwestfrankreich sprach die Bevölkerung die langue d´oc, die alte oczitanische Sprache, in irgendeiner Form. Die Gascogne hatte ihre Sprache, in der ein Neues Testament und fünfzig Psalmen übersetzt wurden, und Béarn hatte béarnais sogar als Amtssprache. Hinzu kam, dass die Bevölkerung in Navarra Baskisch sprach. Wenn Merlin das ganze Land reformieren sollte, musste er diese Sprachbarrieren überwinden, denn die Landbevölkerung musste erreicht und für die Reformation gewonnen werden.
Jeanne d´Albret beauftragte eine Übersetzung des Neuen Testaments ins Baskische, und eine Übertragung der Psalmen, der Zehn Gebote, der Liturgie und des Katechismus Calvins in die Sprache Béarns. Der Anwalt, später Pastor, Arnaud de la Salette, stellte 1571 diese Übersetzung fertig, und obwohl sie erst 1583 gedruckt wurde, darf man annehmen, dass in der Zwischenzeit Manuskriptkopien verwendet wurden. Pastoren, die die béarnesische oder die baskische Sprache beherrschten, wurde händeringend gesucht, und von den Anderen wurde ausdrücklich verlangt, dass sie es lernen sollten. Katecheten, die vermutlich Landeskinder waren, wurden in die Gemeinden geschickt.
Allmählich verbot Jeanne katholische Riten und Gebräuche, zuerst die Fronleichnamsprozessionen, danach Maibäume und Jahrmärkte. Dann wurde die Messe abgeschafft. Der Dom von Lescar und die Kirche St. Martin in Pau wurden leergeräumt, und die dort befindlichen Schätze verkauft.
Für Merlin konnte dies nicht schnell genug gehen. In seinen Briefen an Calvin klagte er seine Not: die Bevölkerung sei stur – diese Holzköpfe! - und die Königin zu langsam und vorsichtig (CO 20, Nr. 3988 & Nr. 4061). Merlin hatte übrigens auch früher in Montargis Probleme mit Renée de France gehabt, Herzogin von Ferrara, die in ihrem Gebiet so vorsichtig war wie Jeanne in Béarn (vgl. Lambin, 2). Jeanne bekam Klagen auf der jährlichen Ständeversammlung, wo die Katholiken über den Verlust alter Freiheiten und Rechte klagten. In den sechziger Jahren musste sie mehrmals Aufstände niederschlagen.
Der Nachfolger für Merlin war Pierre Viret, der enge Freund Calvins. Er war Pastor und Rektor für die Akademie in Lausanne – mit Beza und Merlin als Kollegen – gewesen. Wegen eines Streits mit dem Stadtrat in Bern, übersiedelten 1559 alle Professoren nach Genf, um dort in der neu errichteten Akademie zu unterrichten. Von Genf begab Viret sich nach Frankreich, wo er in Lyon als Pastor arbeitete, danach leitete er die Nationalsynode in Nîmes und schließlich folgte er dem Ruf nach Béarn. Seine wesentlichste Aufgabe war es, die Akademie in Orthez aufzubauen. Die Fächer Theologie, Hebräisch, Griechisch, Philosophie und Mathematik wurden dort unterrichtet, während es keine Anzeigen für Professuren in Jura und Medizin gibt.
Vor ihrer akademischen Laufbahn absolvierten die Jungen eine fünfjährigen Ausbildung in einer Lateinschule (collège), während die Grundschule sowohl Jungen wie Mädchen unterrichtete, die Mädchen allerdings getrennt mit weiblichen Lehrkräften. Damit wurde das kleine Béarn das erste Land Europas, welches kostenlosen Unterricht für Mädchen zusicherte, und zwar mit der interessanten Begründung, dass sie so im Stande waren, ihr Brot zu verdienen und sich der Gesellschaft nützlich zu machen („Pareil rolle sera aussy faict des filles qui sont en bas aage et qui n´ont nul moyen de vivre et de s´entretenir, par toutes les églises, afin que de mesmes deniers et en écolle séparée elles soient enseignées, nourries et tenues par des femmes sages et pudiques, par leur industrie pouvoir aprés se nourrir et entretenir et servir au public“. Art. 32 der Verfassung der Akademie von 1566, zitiert nach Desplat 2004). Desplat unterstreicht die säkulare Ausrichtung der Ausbildung. Allgemein wird behauptet, der Zweck des Unterrichts in protestantischen Ländern sei, die Bevölkerung des Lesens der Bibel und des Katechismus zu befähigen. Hier werden nur die Vorteile eines Schulunterrichts für die Gesellschaft betont.
Die Akademie wurde 1566 geöffnet. Die ersten protestantischen Akademiegründungen in Frankreich fanden in Nîmes (1562) und Montpellier statt. Vorrangiges Ziel war es, die Kirchen mit Pastoren zu versorgen, da die Akademie in Genf die steigende Nachfrage der Gemeinden kaum nachkommen konnte. Da Papst Pius V. die katholischen Universitäten angewiesen hatte, Protestanten die Abschlüsse zu verweigern (Maag 2002, 140), brauchten junge Hugenotten ihre eigenen Universitäten, die dann auch gegründet wurden, vor allem in Leiden und Heidelberg, aber auch in Frankreich und benachbarten Gebieten wie Béarn, Orange und Sedan, die alle zu diesem Zeitpunkt unabhängig waren.
Jeanne hatte sehr gute Gründe, langsam und überlegt vorzugehen. Der Kardinal von Armagnac ließ sie wissen, dass sie die Bevölkerung Béarns in Ruhe lassen sollte, ihre Untertanen wollten ihren Katholizismus nicht aufgeben. Jeanne antwortete, dass sie in Béarn nur Gott über sich habe, dort könne sie ihrem Gewissen folgen, und in ihrem Land werde niemand wegen seines Glaubens verfolgt. Das letzte war ihr ein Anliegen, denn 1571 schrieb sie an ihren Statthalter, den Baron d´Arros, dass in ihrem Land niemand zum Glauben je gezwungen worden war und es auch nicht werden sollte („...intention n´a point esté et n´est encores qu´ilz soyent contraints par force et violence de se reanger à ladite Religion“, d´Aas 2002, 452).
Als sie sich bei der Einführung der Reformation in ihren Ländern unnachgiebig zeigte, zitierte der Papst sie nach Rom zwecks eines Ketzerprozesses. Da sie dieser Einladung nicht folgte, exkommunizierte er sie. Der Bann war eine ernste Bedrohung, da jeder katholische Herrscher jetzt das Recht hatte, ihre Länder an sich zu reißen und sie abzusetzen, eine Chance, die Philipp II. von Spanien sich nicht entgehen lassen würde. Katharina von Medici verteidigte deshalb Jeanne, weil sie keine spanische Präsenz auf der französischen Seite der Pyrenäen dulden wollte. Außerdem war sie eine Verfechterin der gallikanischen Freiheit der französischen Kirche und meinte deshalb, der Papst solle sich nicht in die Angelegenheiten der Kirche einmischen.
Königin der Hugenotten
Nach dem ersten Religionskrieg (1562-63) ließ Katharina von Medici den jungen Karl IX. mündig erklären und führte ihn mit dem Hof auf eine große Frankreichreise, die mehrere Jahre dauerte. Der Zweck dieser Reise war es, den König dem Volk zu zeigen, und damit die Loyalität der Bevölkerung zu erhalten. Jeanne wurde als Vasallin einberufen und stieß Ende Mai 1564 zum Zug in Macon.
Ihr Sohn Heinrich nahm auch Teil an diese Reise und seinetwegen stritten die zwei Königinnen sich, weil Jeanne ihn bei ihren protestantischen Gottesdiensten dabei haben wollte, und Katharina wünschte, dass er mit der königlichen Familie zur Messe gehe. Schließlich sandte Karl IX. Jeanne zu ihrem Besitz in Vendôme, während Heinrich als Gouverneur von Guyenne den Zug begleitete und in den Städten für den feierlichen Empfang des Königs sorgte.
Jeanne durfte nicht mit nach Bayonne, wo Katharina ihrer Tochter Elizabeth, Königin von Spanien, begegnen wollte. Philipp II. sandte als seinen Gesandten den Herzog von Alba, der auf dem Weg in die Niederlande war. Die Hugenotten waren später überzeugt, dass Alba und die Königinmutter in Bayonne ihre Ausrottung geplant hatten. Sicher ist, dass Alba in den Niederlanden mit aller Härte gegen die Protestanten vorging, und es ist durchaus möglich, dass er versuchte, Katharina auf seinen mörderischen Kurs einzustimmen. Schon 1568 – also vor der Bartholomäusnacht! – schrieb Jeanne, dass die Waffen, die gegen die Hugenotten verwendet werden sollten, in Bayonne geschmiedet worden seien (Ample déclaration).
Jeanne und Heinrich trafen sich später in Paris. 1566 ersuchte sie erneut um Erlaubnis, mit ihren beiden Kindern nach Béarn zu fahren, was ausgeschlagen wurde. Sie erhielt aber Erlaubnis, ihren Sohn in seinen französischen Ländereien herumzuführen, und Anfang 1567 reiste sie dann mit ihm nach Vendôme, und von dort setzte sie sich unerlaubt ab nach Béarn. Damit machte sie laut des Biographen Heinrichs, Pierre Babelon, aus einem französischen Prinzen einen Ausländer, und vor allem einen Hugenotten.
Von 1567 an arbeitete Jeanne für die Zukunft ihres Sohnes. Ihre Lebensaufgabe, schrieb sie selbst, sei: Gott, Königtum und ihr Blut. Mit Gott war die reformierte Religion, die wahre Kirche Gottes, gemeint. Mit dem König ihr Status als Vasallin und – trotz Béarn – als Französin, und mit dem „Blut“, die Familie, zuallererst ihr Sohn Heinrich. Er sollte von jetzt an kein Höfling mehr sein, sondern die Aufgaben eines Regenten lernen. Als ein Aufstand in Navarra niedergeschlagen worden war, wurde er dorthin geschickt, um die Basken zu befrieden. Als 14jähriger hielt er für seine Untertanen eine Rede, in welcher er ihr Fehlverhalten geißelte, ihnen die Gunst der Königin zusicherte, falls sie sich verbessern würden, und seinen berühmten Charme mit seinem Autoritätsanspruch verband.
Im Herbst 1567 versuchten die Hugenotten, die sich von der Aufrüstung des Königs bedroht fühlten, Karl IX. in ihre Gewalt zu bringen. Die Entführung missglückte, und die königliche Familie suchte, beschützt von den schweizerischen Söldnern, die die Ängste der Hugenotten verursacht hatten, Zuflucht in Paris. Die Hugenotten belagerten die Stadt. Im November wurden sie vor den Toren von St. Denis geschlagen und mussten sich in die Provinz zurückziehen, wo sie den Kampf bis zum Friedenschluss von Longjumeau im März 1568 fortsetzen.
Der Friedensvertrag war an sich nicht ungünstig für die Hugenotten, nur haperte es wie immer mit der Umsetzung. Katholische Behörden waren über die für die Hugenotten günstigen Bedingungen empört und setzten sie nicht um. Der Protestant La Noue schrieb in seinen Erinnerungen, dass der Krieg zwar viel Unheil bringe, aber dieser elende kleine Friedensvertrag sei viel schlimmer für die Reformierten, die in ihren Häuser umgebracht wurden, ohne dass sie sich zu wehren wagten („ …une guerre est misérable et qu´elle apporte avec soy beaucoup des maux…cette méchante petite paix est beaucoup pire pour ceux de la Réligion, qu´on assassinoit en leur maisons, et ne s´osoyent encores défendre“, d´Aas 2002, 382) Im Laufe des Sommers 1568 versuchten die Gruppierungen noch einmal miteinander zu reden, Karl IX. sandte einen Botschafter nach Béarn, und Jeanne verfasste ein Sendschreiben an den König mit dem Antrag, den Frieden in Guyenne wiederherzustellen.
In der Zwischenzeit fühlten sich der Prinz von Condé und der Admiral Coligny auf ihre Schlösser in Bourgogne zunehmend bedroht. Der Herzog von Alba wollte in den Niederlanden mit Feuer und Schwert den Protestantismus auszurotten, und Flüchtlinge berichteten ihnen von seinem Terror. Am 23. August 1568 flüchteten sie mit ihren Familien und Angehörigen über die Loire nach La Rochelle. Die Überquerung der Loire erinnerte fast an den biblischen Durchzug durchs Schilfmeer: so viele Hugenotten hatten sich angeschlossen, dass der Zug fast wie eine Völkerwanderung aussah, und die Loire hatte in der Augusthitze einen so niedrigen Wasserstand, dass Sandbanken in der Mitte auftauchten. Dementsprechend sangen alle Psalm 114 vom Auszug der Israeliten aus Ägypten, als sie hinüber waren. Die Parallele wurde noch einmal deutlich, als die königlichen Truppen, die sie verfolgten, wegen plötzlich einsetzenden Hochwassers den Fluss nicht überqueren konnten.
In dieser Situation war Jeanne zutiefst gespalten. Bislang hatte sie die Kriege moralisch unterstützt, aber nicht selbst teilgenommen. Falls es zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommen sollte, konnte sie immer mit ihren Kindern in der uneinnehmbaren Festung Navarrenx Zuflucht suchen. Sie hatte jedoch ihren Sohn, der als zukünftiger Führer der Hugenotten das Kriegshandwerk lernen sollte, und so musste sie wählen, ob sie in Béarn unter ihrem Volk bleiben oder sich den Hugenotten anschließen sollte: „ich hatte den Krieg im Bauch“ schrieb sie danach („J´eu la guerre en mes entrailles“, Ample declaration). Sie setzte den Baron d´Arros als Statthalter ein, und Anfang September begab sie sich in Eilmarsch nach La Rochelle (Cocula 2004). Dort konnte sie ihren Sohn dem Prinzen von Condé überantworten. Sie schrieb unterwegs eine Reihe Briefe an Karl IX., an Katharina von Medici, an ihren Schwager, den Kardinal von Bourbon und an die Königin Elizabeth von England, um ihren Entschluss zu begründen. Angekommen in La Rochelle schrieb sie eine Erklärung („Ample declaration“) um der Öffentlichkeit zu erklären, warum sie sich der hugenottischen Armee zugesellte.
Die Hugenotten unter ihren Anführer aus der königlichen Familie wollten nicht als Aufrührer dastehen. Sie behaupteten, die erzkatholische Partei sei schuld daran, dass königliche Befehle nicht vollzogen wurden. Die Katholiken mit ihren Verbindungen nach Spanien und Rom seien Landesverräter. Die Politik des Kardinals von Lorraine verdient laut Sutherland (1974) keinen anderer Namen. Wenn Jeanne vom Frieden sprach, meinte sie eine Duldung der Hugenotten in Frankreich. Die Forderungen der Hugenotten waren immer dieselbe: Erlaubnis, Gottesdienste zu feiern, Gerichte mit zur Hälfte hugenottischen Richtern, sichere Zufluchtsstädte – deren Anzahl schwankte in den Verhandlungen – und Zugang zu Ausbildung und Beamtenstellen gleichrangig mit den Katholiken. Die Provinz Languedoc unter dem moderat katholischen Gouverneur Montmorency-Damville war ein friedlicher Ort in den Religionskriegen, weil Damville den Hugenotten solche Rechte einräumte, und die katholische Bevölkerung sich damit abfand.
Im März 1569 fand eine Schlacht bei Jarnac statt. Der Prinz von Condé kämpfte mit, wurde verwundet und nach der Schlacht ermordet. Es gelang Admiral Coligny, die hugenottischen Truppen zusammenzuhalten, aber der Verlust des Prinzen war ein herber Schlag. Heinrich von Navarra war jetzt der ranghöchste Prinz, und zusammen mit seinem Vetter, dem gleichaltrigen Heinrich von Condé, wurde er jetzt Oberbefehlshaber über die Armee der Prinzen. In Wirklichkeit lag die Verantwortung für die Kriegsführung bei dem erfahrenen Admiral, und die beiden Prinzen wurden seine Pagen genannt.
Jeanne blieb in La Rochelle, während Coligny mit den Prinzen im Krieg war, und sie konnte, unterstützt von einem Rat adliger Hugenotten, die „Regierungsgeschäfte“ regeln. Sie schrieb an England und nach Deutschland. Sie unterzeichnete Erlässe, versuchte Geld für das Heer aufzutreiben, pfändete ihren schönsten Schmuck für einen Kriegsdarlehen an Elizabeth von England und ließ ein Kriegsschiff namens „Die Hugenottin“ bauen.
So wie sie immer behauptete, nicht gegen den König, sondern gegen seine schlechten Ratgeber zu kämpfen, so behauptete Karl IX., dass sie in La Rochelle von den Hugenotten gefangen gehalten wurde, und er ließ den Baron Terride mit einer „Befreiungsarmee“ in Béarn einfallen. In kürzester Zeit waren ganz Béarn und Navarra erobert und zum Katholizismus zurückgeführt. Nur der Baron d`Arros hielt im Navarrenx stand. Um ihre Länder zurückzuerobern, sandte Jeanne den Graf von Montgommery mit einer „Hilfsarmee“ nach Navarrenx. In noch kürzerer Zeit als Terride gebraucht hatte, verjagte er ihn aus Béarn. Die Befreiung von Terride wurde in Pau mit einem Festgottesdienst gefeiert, wobei Pierre Viret über Psalm 124, 7: „Unsere Seele ist aus dem Netz des Vogelfängers entkommen“ predigte.
Vom Winter 1569 bis zum Frühjahr 1570 führte Coligny sein Heer mit den Prinzen Heinrich von Navarra und Heinrich von Condé durch ganz Südfrankreich und von Provence nach Norden, bis er Paris bedrohte. Der König hatte kein Geld mehr, um Krieg zu führen, und musste notgedrungen Friedensverhandlungen einleiten. Im August 1570 wurde dann der Frieden von St. Germain geschlossen. Wiederum war Jeanne d´Albret diejenige, die auf Augenhöhe mit dem König verhandeln konnte. Der Vertragstext erklärt immer wieder, dass der König die Bedingungen seiner Tante erfüllen wollte (Sutherland 1980, Potter 1997).
Jeanne blieb vorläufig in La Rochelle. Im April 1571 fand dort die Nationalsynode der reformierten Kirchen Frankreichs statt. Theodor Beza kam aus Genf angereist, um die Synode zu leiten. Pierre Viret wollte teilnehmen, starb aber vorher, vermutlich hatte seine Gesundheit in der Gefangenschaft unter Baron Terride gelitten. Auf der Synode wurde das französische Glaubensbekenntnis von 1559 neu verhandelt und die endgültige Fassung als „Bekenntnis von La Rochelle“ beschlossen. Darüber hinaus wurde eine Kirchenordnung für Béarn beschlossen, und die Synode diskutierte Fragen, die Jeanne d´Albret gestellt hatte. Als Ersatz für Pierre Viret bekam sie Nicolas des Gallars zur Seite gestellt. Er war Calvins Sekretär gewesen, danach hatte er die „Strangers´ Church“, die Kirche für Ausländer in London, als Nachfolger für Johannes à Lasco geleitet und dann an Bezas Seite im Colloquium von Poissy 1561 gestanden. Er war Pastor in Orléans gewesen und wurde jetzt Seelsorger für Jeanne d´Albret und ihr theologischer Ratgeber für die Kirche in ihrem Land.
Er war eine gute Wahl, denn während Beza sehr an dem Konzept von Genf hing und ein presbyteriales Kirchenverständnis (Kingdon 1967) hatte, war des Gallars in England gewesen, als Königin Elizabeth nach dem Tod ihrer katholischen Schwester die anglikanische Kirche einführte. Außerdem behauptet Bernard Roussel (2004), dass er das Buch Martin Bucers „De regno Christi“ von 1550 mitbrachte. Dieses Buch ist dem englischen König Edward VI. gewidmet und beschreibt, wie ein König eine reformierte Kirche leiten kann. Damit hatte des Gallars ein Konzept für eine von einer Fürstin geleitete Kirche, die dann in den Jahren als Heinrich und Katharina von Navarra das Erbe der Mutter verwalteten, Bestand hatte.
Während Jeanne in La Rochelle noch weilte, ereilte sie ein Angebot von Katharina von Medici, ob ihren Sohn Heinrich die Tochter Katharinas heiraten mochte. Hugenotten und Katholiken würden sich versöhnen und die Häuser Valois und Bourbon sich nahekommen. Dieses Angebot war zu verlockend, um es auszuschlagen, aber Jeanne traute Katharina nicht so recht, jedenfalls wollte sie nicht gleich nach Paris ziehen, um über die Ehe zu verhandeln.
Stattdessen fuhr sie nach Pau zurück, führte die neu beschlossene Kirchenordnung ein und kümmerte sich um ihre Länder. Die Tuberkulose machte sich bemerkbar und sie wollte zur Kur in die Bergen fahren. Währenddessen zogen sich die Eheverhandlungen hin, bis Jeanne endlich im Frühjahr 1572 nach Paris zog. In den Briefen an ihren Sohn hört man von den Verhandlungen, von ihrer Missbilligung des höfischen Lebens und von ihrem Ärger mit Katharina. Jeanne wollte so viele Rechte wie möglich für ihren Sohn und die Hugenotten aushandeln. Am Ende musste sie es aufgeben, Margareta von Valois, Margot genannt, zum reformierten Glauben zu bekehren. Dafür hoffte sie aber, dass das Brautpaar nach Béarn ziehen würde. Eine königliche Mischehe war etwas ganz Neues und musste in Detail besprochen und geplant werden. Jeanne handelte das Meistmögliche für ihren Sohn aus und im April 1572 wurde eine Einigung erzielt. Heinrich sollte allerdings noch eine Weile in Béarn bleiben und Jeanne bereitete in Paris die Hochzeit vor.
Die zähen Verhandlungen im Frühjahr hatten viel Kraft gekostet, Jeanne hielt sich aber tapfer. Im Juni brach sie zusammen und starb am 9. Juni an der Tuberkulose, die sie seit Jahren geplagt hatte. Später entstanden Gerüchte, sie sei von Katharina von Medici vergiftet worden. Diese sollte ihr ein Paar Handschuhe, die von ihrem privaten Giftmischer präpariert worden seien, geschenkt haben. Da Katharina nach den Massakern von St. Bartholomäus, die in der Periode von August bis November 1572 stattfanden, von den Hugenotten als der Inbegriff des Bösen dargestellt wurde, gehört der Giftmord an Jeanne d´Albret zu den Verleumdungen.
Heinrich traf erst etwas später in Paris ein. Im Testament Jeannes hatte sie sich gewünscht, in Béarn bei ihrem Vater beerdigt zu werden. Ihr Sohn setzte sich über ihren letzten Willen hinweg: sie wurde nach Vendôme geführt und neben ihrem Mann, Anton von Bourbon, bestattet.
Trotz ihre Fähigkeiten wurde sie eine Fußnote in der Geschichte Frankreichs: ihr Sohn wurde zwar als Heinrich IV. König von Frankreich, aber er wurde katholisch und aus den Hugenotten wurde, dank des Ediktes von Nantes 1598, eine geduldete Minderheit. Die Kirche, die Jeanne in Béarn aufgebaut hatte, wurde unter ihrem Enkelsohn, Ludwig XIII., verboten. 1685 wurde dann das Edikt von Nantes aufgehoben, und die Reformierten wurden grausam verfolgt. Viele flüchteten, viele konvertierten und viele wurden umgebracht. Die großen Hoffnungen, die die Hugenotten um Jahr 1560, als Jeanne konvertierte, hegten, erwiesen sich als trügerisch.
Wenn auch letztlich nicht erfolgreich, war sie dennoch bewundernswert. Mit dem Admiral Coligny zusammen hatte sie den Frieden von St. Germain errungen, dann eine Landeskirche aufgebaut und ihre Kinder gefördert. Sie war die reformierte Präsenz in der königlichen Familie und in ihren letzten Jahren wurde sie die Königin der Hugenotten.
Stammtafeln der Familie von Valois und der Familie von Bourbon (PDF)
Literatur
Quellen:
Albret, Jeanne d´: Lettres suivies d´une ample Déclaration, ed. Bernard Berdou d´Aas, Biarritz 2007.
Bordenave, Nicolas de: Histoire du Béarn et de la Navarre, Paris 1873.
Bucer, Martin: De regno Christi: libri duo, 1550, ed. François Wendel, in: Robert Stupperich, Hrsg. Ser. 2, Opera latina Bd. 15,1, Gütersloh 1955. In: Studies in Medieval and Reformation Thought, Leiden 1982. „Du royaume de Jesus Christ“, édition critique de la traduction française de 1558/texte établi par François Wendel, Bd.15,2, Gütersloh 1954.
Calvin, Johannes: Calvini opera quae supersunt omnia (= CO), hrsg.v.W.Baum, E.Kunitz, E.Reuss, 59 Bde, Braunschweig/Berlin 1863-1900.
Calvin-Studienausgabe (= CStA), hrsg.v. E.Busch u.a., Neukirchen-Vluyn ab 1994.
Coudy, Julien, ed.: Die Hugenottenkriege in Augenzeugenberichten, Darmstadt 1965
Potter, David, ed.: The French Wars of religion, Selected Documents, London & New York 1997.
Ruble, Alphonse de: Le mariage de Jeanne d´Albret, Paris 1877.
Ruble, Alphonse de: Antoine de Bourbon et Jeanne d´Albret, Paris 1881, 1882, 1885 & 1886, 4 Bde.
Ruble, Alphonse de: Jeanne d´Albret et la guerre civile, Paris 1897.
Ruble, Alphonse de: Mémoires et poésies de Jeanne d´Albret, Paris 1893, Slatkine Reprints Genf 1970 (online auf Französisch: https://archive.org/details/mmoiresetposies00rublgoog).
Stegman, A.: Les édits des guerres de religion, Paris 1979.
Sekundärliteratur:
Aas, Bernard Berdou d´: Jeanne III d´Albret, Chronique 1528-1572, Anglet 2002.
Actes du colloque “Arnaud de Salette et son temps – Le Béarn sous Jeanne d´Albret”, Orthez 1984 (war mir leider nicht zugänglich).
Actes du colloque “L ´Amiral de Coligny et son Temps”, Paris 1974.
Actes du colloque “Jeanne d´Albret et sa cour”, Paris 2004.
Babelon, Pierre: Henri IV, Paris 1982.
Benedict, Philip, ed.: Reformation, Revolt and Civil War in France and the Netherlands 1555-1585, Amsterdam 1999.
Benedict, Philip: “Confessionalization in France? Critical reflections and new evidence”, in: Mentzer & Spicer: Society and Culture in the Huguenot World 1559-1685, Cambridge 2002.
Bryson, David: Queen Jeanne and the Promised Land, Dynasty, Homeland, Religion and Violence in Sixteenth Century France, Leiden 1999.
Buisseret, David: Henry IV, London 1984.
Cazaux, Yves: Jeanne d´Albret, Paris 1973.
Cholakian, Patricia F. & Cholakian, Rouben C.: Marguerite of Navarre, Mother of the Renaissance, New York 2006.
Cocula, Anne-Marie: ”Été 1568. Jeanne d´Albret et ses deux enfants sur le chemin de La Rochelle”, Actes du colloque ”Jeanne d´Albret et sa cour”, Paris 2004.
Desplat, Christian: “Jeanne d´Albret, un modèle d´éducation maternelle?”, in: Actes du colloque ”Jeanne d´Albret et sa cour”, Paris 2004.
Eurich, Amanda: “Le pays de Canaan”: L´évolution du pastorat béarnais sous Jeanne d´Albret”, in: Actes du colloque “Jeanne d´Albret et sa cour”, Paris 2004.
Graeslé, Isabelle: Vie et légendes de Marie Dentière, Bulletin du centre protestant d´études, Genéve 2003.
Greengrass, Mark: “The Calvinist experiment in Béarn”, in: A. Pettegree, A. Duke & G. Lewis: Calvinism in Europe 1540 - 1620, Cambridge 1994.
Kingdon, Robert M.: Geneva and the Consolidation of the French Protestant Movement 1564-1572, Genève 1967.
Knecht, R.J.: Catherine de´ Medicis, London 1998.
Kuperty-Tsur, Nadine: “Jeanne d´Albret ou la persuasion par la passion”, in: Actes du colloque “Jeanne d´Albret et sa cour”, Paris 2004.
Lambin, Rosine: Calvin und die adelige Frauen im französischen Protestantismus, http://www.reformiert-info.de/2304-0-0-20.html
Maag, Karin: “The Huguenot academies: preparing for an uncertain future”, in: Mentzer & Spicer: Society and Culture in the Huguenot World 1559-1685, Cambridge 2002.
Martin-Ulrich, Claudie: “Récit de vie, récit de mort: Le Brief discours sur la mort de la royne de Navarre, Jeanne d´Albret” in: Actes du colloque “Jeanne d´Albret et sa cour”, Paris 2004.
Mentzer, Raymond A. & Spicer, Andrew, eds.: Society and Culture in the Huguenot World 1559-1685, Cambridge 2002.
Nielsen, Merete: Theologie als Erzählung – erzählte Theologie, Das Heptameron von Margarete von Navarra, http://www.reformiert-info.de/side.php?news_id=5444&part_id=0&navi=4
Nielsen, Merete: Marie Dentière,
Auf den Spuren König Davids
Johannes Calvin als Ausleger der Psalmen

Ein Aspekt aus Johannes Calvins Wirken, der für den reformierten Protestantismus von elementarer Bedeutung ist, verdient Aufmerksamkeit: das Hören und Lesen der Bibel und ihre Auslegung in der Predigt. Von Anfang an versteht sich die Reformierte Kirche als Kirche des Wortes, insofern sie von seiner Kraft her lebt sowie ihr Reden und ihr Tun immer wieder an die ausgelegte biblische Botschaft als ihr Kriterium zurückbindet. Theologischer Unterricht heißt für Calvin Auslegung der Schrift.
1. Calvins Psalmenauslegung als authentischer Ausdruck seiner Theologie
Calvins Auslegung der Psalmen[1] erschien erstmals vor 450 Jahren, im Jahr 1557, und ist somit ein Spätwerk, dem die Reife der Auslegungskunst anzumerken ist. Seine Erklärungen sämtlicher 150 Psalmen, die den Umfang von mehr als 1300 enggedruckten Spalten haben, gehen auf seine Genfer Vorlesungen zurück. Calvin hält sich nach dem Vorbild Ulrich Zwinglis (1525) und Leo Juds (1532) möglichst eng an den hebräischen Urtext und übersetzt ihn wortgetreu – gelegentlich auch unter Verzicht auf sprachliche Eleganz oder poetische Schönheit – ins Lateinische. Er hat die so entstandene und manchmal schwer verständliche Übersetzung selbst „barbarisch“ genannt, doch er hat sie bewusst in Kauf genommen, weil es ihm um die „hebraica veritas“, also um den authentischen historischen Schriftsinn, ging.
Calvins Beschäftigung mit den Psalmen fällt in eine Zeit heftiger Auseinandersetzungen um den Weg der Genfer Kirche: Anfang der 50er Jahre findet die Kontroverse mit Hieronymus Bolsec um die Erwählung statt, außerdem der Streit mit Michael Servet über die Dreieinigkeit Gottes sowie Kämpfe in der Gemeinde um Kirchenzucht und Abendmahlsausschluss. Anfeindungen, Verleumdungen und Kämpfe, von denen die Psalmen sprechen, gewinnen für Calvin eine unerwartete Aktualität und lassen den Psalter für Calvin zu einem Trostbuch ersten Ranges werden. Immer wieder trägt Calvin direkt oder indirekt seine eigenen Kämpfe in die Auslegung ein, so etwa zu Psalm 41,10 („Auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, tritt mich mit Füßen“), wo er erklärt: „Die Aufzählung seiner Leiden beschließt David mit der Klage darüber, dass er sogar von einem seiner besten Freunde Treulosigkeit erfahren musste. Vielleicht ist aber trotz der Einzahl an mehrere treulose Freunde zu denken.“ Auch setzt er das Leiden des Psalmisten in Beziehung zum Leiden Christi, um über die christliche Gemeinde zu sagen, sie habe ihre Feinde innerhalb und außerhalb der Gemeinde.
Wie hoch Calvin die Psalmen geschätzt hat, geht auch aus seiner Vorrede zur französischen Psalmenübersetzung von Louis Budé (1551) hervor. Das Buch der Psalmen sei ein Spiegel, der uns zeigt, was uns zum Gebet sowie zum Dank und Lobpreis Gottes führen soll, wenn er unser Gebet erhört. Die Beziehung von Gott und Mensch erkennt Calvin als das große Thema der Psalmen. Der Calvinforscher Herman Selderhuis nennt darum die Psalmen zu Recht das „Herz“ der calvinischen Theologie.[2] Wir begegnen Calvin als einen mit seiner ganzen Person engagierten Interpreten, der ein Gespräch mit dem Text einerseits und mit den Hörern bzw. Lesern andererseits führt.
Schon die Vorrede gibt einen Hinweis auf seine persönliche Präsenz in der Auslegung: „Die Leser müssen wohl erkennen, dass die Erfahrungen, die mich Gott … im Kampf hat erleiden lassen, mir mehr als gewöhnlich geholfen haben, nicht nur alle Lehrstücke … für den gegenwärtigen Gebrauch anwendbar zu machen, sondern auch die Absichten der Schriftsteller jedes Psalms besser zu erkennen.“ Calvin ist der festen Überzeugung, dass seine eigenen Erfahrungen die Arbeit am Text nicht behindern, sondern im Gegenteil ihn tiefer in den Sinn der Texte blicken lassen.
Er selbst erkennt sich in der Gestalt Davids wieder – also im Autor der Psalmen nach der Sicht der Alten Kirche und der Reformation. In seiner unerwarteten Berufung zum Reformator, in seiner oft angefochtenen Stellung in Genf, in seinen Kämpfen und Niederlagen bei der Arbeit an der Erneuerung der Kirche: Hier identifiziert sich Calvin mit David. Hinter diesen persönlichen Erfahrungen wird das Bild der alttestamentlichen Gemeinde sichtbar, in der Calvin das Vorbild der Kirche Jesu Christi erkennt. Deshalb spricht er von den „mannigfachen und glänzenden Reichtümern“, die „dieser Schatz [der Psalmen]“ enthält. Die Psalmen sollen letztlich „dem Aufbau der Kirche dienen“.
Seit 1549 predigt Calvin nahezu Sonntag für Sonntag über die Psalmen, bis er 1554 auch den letzten Psalm ausgelegt hat. Leider sind die Predigten im Unterschied zu den Vorlesungen zum großen Teil verloren gegangen. Ein weiteres Indiz für die einzigartige Bedeutung, die er den Psalmen beigemessen hat, liegt darin, dass er seiner Sonntagspredigt sonst durchweg neutestamentliche Perikopen zugrunde legt und nur bei den Psalmen eine Ausnahme macht. Parallel zu diesen Predigten macht er die Psalmen ab 1552 zum Thema seiner Vorlesungen an der Genfer Akademie. Calvin hat sich nahezu ein ganzes Jahrzehnt so intensiv mit den Psalmen beschäftigt, dass sie ihm in dieser Zeit zur wichtigsten biblischen Grundlage seiner Theologie wurden. Und es ist interessant zu beobachten, wie diese exegetische Arbeit auf die Endfassung des „Unterrichts in der christlichen Religion“ von 1559 eingewirkt hat: Manche Spur führt von den Psalmen zur Behandlung der Vorsehung, der Erwählung, den Abschnitten zum christlichen Leben und zum Gebet.
Calvin stellt seiner Psalmenauslegung eine bemerkenswerte Vorrede voran, die eine der wichtigsten Quellen für sein biographisches Selbstzeugnis ist. Das wiegt umso schwerer, da Calvin sonst relativ selten über sein eigenes Leben spricht. Berühmt ist die Vorrede in erster Linie wegen des Satzes von der „plötzlichen Hinwendung zur Gelehrsamkeit“ (subita conversio ad docilitatem). Man sollte darunter nicht ein ganz bestimmtes Datum der Bekehrung oder reformatorischen Wende erkennen, sondern den Ausdruck dafür, dass seine Hinwendung zur Reformation unerwartet geschah.
Dieses Unerwartete, dass der Jurist und Humanist zum Reformator wurde, sieht dieser unter dem Vorzeichen, dass Gott diesen Prozess in ihm ausgelöst hat: In der Sache unerwartet habe Gott ihn mit den Gaben ausgerüstet, die ihn zur Übernahme der Aufgabe in Genf befähigten. Von der Vorrede fällt ein Licht auf Calvins Selbstverständnis als Prediger des Evangeliums von der Gerechtigkeit und Barmherzigkeit Gottes. Denn hier begegnet uns Calvin in seiner theologischen Leidenschaft, an der Seite von König David dem Reichtum der Gottesrede auf den Grund zu gehen. Auf intensives Drängen hin habe er sich zur Veröffentlichung dieses Werkes entschlossen – beflügelt durch die Annahme, dass sein Werk von erheblichem Nutzen für das Verständnis der Gebete und Lieder Israels sein werde, die er als „Kostbarkeiten“ und „Schatzhaus“ bezeichnet.
Zwei Argumentationslinien verdienen besondere Aufmerksamkeit. Erstens legt Calvin seiner Auslegung den Gedanken zu Grunde, dass die Psalmen eine Zergliederung aller Teile der Seele seien, so dass jeder in ihnen ein Spiegelbild seiner inneren Regungen zu finden vermag. Demnach führt der Heilige Geist in ihnen Schmerzen, Traurigkeit, Befürchtungen, Zweifel, Hoffnungen, Sorgen, Ängste und Verwirrungen lebendig vor Augen. Sie bieten den Menschen die Möglichkeit, sich selbst in ihrem zwischen Trost und Trostbedürftigkeit schwankenden Seelenzustand wiederzuerkennen.
Das gesamte Spektrum menschlicher Empfindungen einschließlich ihrer Gottesbeziehung begegnet in den Psalmen in der Weise, dass die Menschen es mit ihrem eigenen Leben in Beziehung setzen können. Ziel dieses Identifikationsprozesses ist die Aufrichtigkeit, in der die Menschen ihres eigenen Lebens samt ihrer Grenzen, Schwächen und Abgründe ansichtig werden. Aufklärung des Menschen über sich selbst statt naive Selbsttäuschung verspricht Calvin dem, der die Psalmen studiert. Darüber hinaus bewirkt ihre Lektüre die Zunahme an „himmlischer Weisheit“ und leitet zuverlässig zur Anrufung und zum Lob Gottes im Gebet an. Vermittlung von himmlischer Weisheit und Anleitung zum Gebet: darauf zielt die gesamte Auslegung der Psalmen.
Hinzu kommt eine zweite Argumentationslinie: Calvin entdeckt im Psalmisten David sein eigenes Leben und das der bedrängten Kirche wieder. Um David und seine gelegentlich klagende Rede zu Gott zu verstehen, macht sich Calvin über sein eigenes Leben Gedanken und nimmt identisches Erleben und ähnliches Erleiden wahr. Davids Erfahrungen gelten ihm als „Spiegel“ seines eigenen Erlebens, manchmal auch als Vorbild. Das Leben und Erleben Davids wird ihm zur Vorabbildung der eigenen Biographie. So geschehen Selbstvergewisserung und Selbstzeugnis, angestoßen und geweckt durch die Beschäftigung mit den Psalmen.
Es geht beim Verstehen der Psalmen um eine theologische Bemühung, die sich biographisch auswirkt. Von Gott redet Calvin gleichsam als dem Autor, der seine Biographie schreibt: „Wie [David] von den Schafhürden zur höchsten Würde erhoben worden ist, so hat Gott auch mich von den dunkelsten und geringsten Anfängen emporgehoben und hat mich gewürdigt, das hohe Amt eines Verkündigers und Dieners des Evangeliums zu bekleiden.“ Calvin betont in alldem die Souveränität und Subjektivität Gottes, der in Davids und in seiner eigenen Biographie von sich reden macht, indem er die Ausrichtung des Lebens bestimmt. Diesen Gedanken hat im 20. Jahrhundert Elie Wiesel einmal so umschrieben: „Gott will am Anfang und auch am entscheidenden Ende unserer Handlungen sein. Er ist Frage und Antwort zugleich.“[3]
Es ist spannend zu beobachten, wie sich in der Psalmenauslegung die Theologie biographisch konkretisiert und umgekehrt die Biographie theologisch reflektiert wird. Das Verständnis von Gott als dem Autor des eigenen Lebens erweist nach Calvins Selbstzeugnis seine besondere Kraft im Bestehen der Not. Auch in dieser Überzeugung weiß sich Calvin mit David verbunden, der weniger als machtvoller König denn als nachdenklicher Dichter gezeichnet wird. In einer Predigt über Psalm 27 sagt Calvin: „David war ganz Mensch, den gleichen Leidenschaften unterworfen, die uns dann und wann quälen und umtreiben. Doch um eine feste Führung zu haben, gibt er Acht auf das, was Gott ihn sehen lässt.“ Und am Ende der Psalmenvorrede spricht Calvin vom Trost, in David ein Vorbild zu haben, und schließt: „Die Leser werden (...) merken, dass ich, wenn ich die geheimen Gedanken Davids (...) entwickle, wie von persönlich Erlebtem rede.“ Calvin zeigt auf, wie die Gotteserkenntnis die Basis für die Deutung des eigenen Lebens bildet.
2. Das Reden von Gott in den Psalmen
2.1. Gott der König
Aus der Fülle der Gottesbezeichnungen ist die Bezeichnung „König“ besonders vielsagend, weil sie in Nachbarschaft zum reformierten Leitgedanken des „Allein Gott die Ehre“ (soli Deo gloria) steht. Auf den ersten Blick steht die Redeweise von Gott als König in Spannung zu unserer Wirklichkeit, der die Vorstellung des Königtums weithin abhanden gekommen ist. Wenn Calvin die Jahwe-Königs-Psalmen 47, 93 und 96-99 auslegt, kann man feststellen: Calvin versteht unter dem Königtum Gottes seine Weltregierung und zieht Konsequenzen für das Leben der Gläubigen. Wo von Gottes Königtum die Rede ist, geht es sogleich um die Stellung des Christen in der von Gott regierten Welt.
Die Hervorhebung Gottes als König mit Macht begründet die Zuversicht der Gemeinde, in den Bedrängnissen dieser Welt bei Gott Schutz zu finden. Würden die Christen Gottes universales Wirken in Abrede stellen, gerieten sie unweigerlich in Furcht und Zittern. Calvin wörtlich: „Darin also steht Gottes Ruhm, dass das Menschengeschlecht nach seinem Willen regiert wird.“ (Ps 93,1). Gottes Sorge um die Welt und den einzelnen Menschen vollzieht sich mit „wunderbarer Weisheit und Gerechtigkeit“ (Ps 93,1f.). Und seine ordnende Herrschaft überragt nicht nur alles Irdische, sondern auch alle himmlische Herrlichkeit und alles, was sonst göttlich genannt wird (Ps 95,3). Wie sich Gottes Herrschaft in kosmische Dimensionen hinein erstreckt, so dehnt sie sich auch auf der ganzen Erde bis in die äußersten Winkel aus (Ps 47,9).
Calvin legt den Akzent auf die ökumenische Sammlung der Gemeinde, um sie unter dem Wort und der Lehre Gottes zu einer Einheit zu formen. An anderer Stelle unterstreicht er die Lebensdienlichkeit von Gottes königlicher Herrschaft: Heil, völliges Glück und Gerechtigkeit leuchten in aller Welt, ausgehend von den Juden bis hin zu den Völkern, unter Gottes königlicher Herrschaft auf (Ps 97,1). Diese Macht Gottes schließt die Bestrafung des Unrechts und die Bewahrung der Juden als seinem auserwählten Volk vor den sie umgebenden Feinden ein – ein Satz, der angesichts der Vernichtungsdrohungen gegen Israel bis heute aktuell ist. Macht und Recht, so Calvin, sind in dieser königlichen Herrschaft miteinander verbunden mit dem Ziel, dass auch im Zusammenleben der Menschen Gerechtigkeit wachse (Ps 99,1.4).
Gottes Herrschaft bedeutet also bei Calvin Schutz und Ordnung der Welt, keineswegs aber Tyrannei (Ps 145,10; 99,4). Calvins Zentralerkenntnis der Souveränität Gottes, die in der Neuzeit gelegentlich als Triumph Gottes über den Menschen missverstanden wurde, steht nicht im Gegensatz zur menschlichen Freiheit. Schließlich geht es bei Calvin um die Souveränität des Gottes des Evangeliums und nicht um eine abstrakte Überlegenheit und Mächtigkeit. Calvins Theologie hat darum nicht einen, sondern zwei Brennpunkte: die Ehre Gottes im Sinne seiner gerechten Souveränität und das Heil des Menschen im Sinne seiner Befreiung durch Gottes Barmherzigkeit.
Beides bleibt aufeinander bezogen, wie Calvin im Genfer Katechismus (1545) erklärt: „Gott selbst hat in seiner unendlichen Güte alles so gestaltet, daß alles, was zu seiner Ehre dient, auch für uns heilvoll ist.“ (Frage 258). Mit der Souveränität Gottes ist also keine schrankenlose, absolute Herrschaft gemeint. Es geht vielmehr um seine ihm zukommende gerechte Macht, und zwar eine Macht, in der er daran gebunden ist, in allem, was er tut, Gott zu sein. Diese Macht steht nicht im Widerspruch zu dem, was er faktisch tut, und nicht im Widerspruch zu seinem guten Willen zu Gunsten des Menschen. In seiner Souveränität behauptet sich Gott gegen alle Egomanie des Menschen, der gefährdet ist, selbst nach göttlicher Verehrung zu streben.
Calvins Einsicht in Gottes Regieren bedeutet zugleich eine seelsorgerliche Vergewisserung der Menschen. Zwar sei es keineswegs so, dass das Erkennen und Anerkennen Gottes zwangsläufig ein geordnetes, ruhiges und friedliches Leben nach sich zieht: „Wohin ein Mensch auch blickt, er wird umringt von einem Labyrinth von Gefahren“ (Ps 30,6). Und an anderer Stelle: „Das Verlassen des Mutterschoßes ist der Eintritt in tausend Tode“ (Ps 71,5). Calvin muss einräumen, dass ein unendlicher Kontrast zwischen unserem verletzlichen kurzen Leben und Gottes ewigem Regieren besteht (Ps 102,13).
Seine Wirklichkeitserfahrung, die durch sein Leiden an der Genfer Gemeinde geprägt ist, lässt ihn von einem vollständigen Durcheinander (confusio) der Welt und der menschlichen Verhältnisse sprechen (Ps 25,13; 30,7). Wo Gott und Mensch einander begegnen, treffen Leben und Tod aufeinander, und zwar so, dass der Mensch mitten in der chaotischen Welt die Festigkeit des Reiches Gottes wahrnehmen (Ps 1,5) und innere Ruhe finden kann (Ps 37,29). Die Paradoxie lässt sich nur dadurch auflösen, dass das Fundament dieser inneren Ruhe außerhalb des Menschen in Gott liegt. Die Argumentation zielt auf das Einstimmen in den Weg, den Gott mit den Menschen beschreitet (Ps 25,13).
Es fällt auf, dass Calvin im Angesicht des wahrgenommenen irdischen Chaos – man denke nur an die Glaubensflüchtlinge und die Gemeinden unter dem Kreuz, die Calvins Leserschaft waren – die Spannung zwischen himmlischer Ordnung und irdischem Geschick nicht harmonisiert. Im Gegenteil: Das irdische Leben ist unter dem Zeichen des Kreuzes verborgen (vgl. Inst. II,16). Auch wenn der Christ unter der Herrschaft Gottes lebt, ist und bleibt er ein Fremder und Durchreisender auf Erden (Ps 37; 4,7).
2.2. Gott als der Schöpfer von Himmel, Erde und Mensch
Calvin legt in der Auslegung der Schöpfungspsalmen großen Wert darauf, dass Gott und seine Schöpfung auf Dauer zusammengehören. Mit großem Nachdruck unterstreicht er, dass Gott aktiv – also „niemals nichts tuend“ (non otiosus) – an der ganzen Wirklichkeit teilnimmt. Er wendet sich entschieden gegen den griechischen Philosophen Epikur (341-270 v. Chr.), dem zufolge die Erde zufällig aus der Verbindung von allerlei Atomen entstanden sei: „Die Welt ist nicht ewig ..., sondern die wunderbare Ordnung, die wir vor uns sehen, ist auf Gottes Befehl ... entstanden.“ (Ps. 148,7).
Er vertieft den Gedanken in die Richtung, dass die Welt durch das Wort geschaffen ist (Ps. 33,6). Schon in seinem schöpferischen Handeln ist Gott gnädig, um Land zum Leben entstehen zu lassen (Ps. 136,4). Gemäß dem Grundprinzip seiner Theologie bezweckt die Schöpfung ein Doppeltes: Gottes Ehre und das Heil des Menschen. Alles hat Gott geschaffen, damit die Menschen seinen Namen preisen (Ps. 113,1) und sich im Loben Gottes üben (Ps. 11,10): „Wir wissen, dass wir auf diese Erde niedergesetzt sind, um mit einem Herzen und aus einem Munde Gott zu loben, und dass dies das Ziel unseres Lebens ist.“ (Ps. 6,6).
Wie der Mensch um Gottes willen geschaffen ist, so kann Calvin nun auch umgekehrt erklären, dass die Welt um des Menschen willen gemacht ist (Ps. 147,7): „Gott hat die Menschen geschaffen und in diese Welt gesetzt, damit er für sie ein Vater sein kann.“ (Ps. 89,47). Das ist der Grund von Gottes Sorge für die Welt: dass wir seine väterliche Fürsorge bemerken und seine Wohltaten genießen (Ps. 115,16). Das ideale Leben kann sich Calvin nicht anders als ein Leben mit Gott vorstellen, und ein solches Leben trägt die Züge von Heiterkeit und Zufriedenheit (Ps. 16,9).
Dass Calvins Psalmauslegung eine entscheidende Station auf dem Weg zur Endfassung der Institutio war, zeigt sich auch an der Bezeichnung der Schöpfung als „Schauspiel der Ehre Gottes“ (theatrum gloriae Dei): Er nennt die Welt „das Schauspiel von Gottes Güte, Weisheit, Gerechtigkeit und Kraft“ (Ps. 125,13; vgl. Ps. 19,7). Und in der „Institutio“ erklärt er, Gott habe die gesamte Welt „zu dem Ziel erschaffen, dass sie Schauspiel seiner Herrlichkeit sein sollte“ (Institutio III,9,4). An anderer Stelle spricht er vom Weltall als dem Spiegel von Gottes Pracht (Ps. 19,1). Aber auch in seinen Geschöpfen offenbart Gott, wer er ist: „Ist nicht der Walfisch, der mit seinen Bewegungen nicht nur das ganze Meer, sondern auch das Herz eines Menschen in Aufruhr versetzt, ein schlagender Beweis der beeindruckenden Macht Gottes?“ (Ps. 104,25). Um Gott aber vollkommen zu verstehen, ist noch eine andere Stimme als die der Natur nötig: sein Wort, ohne das der Mensch für Gottes Wesen blind bleibt.
Aufs Engste gehören Schöpfung und Freiheit zusammen: Die Beziehung, die Gott in der Schöpfung zum Menschen eingeht, ist geprägt von seiner Freiheit. Gott erschafft die Welt nicht, weil er sie braucht, sondern weil er sie will. Wie schon in sich selbst, so bleibt Gott auch in der Zuwendung zu seinen Geschöpfen frei. Anders als bei Martin Luther, der von der vollkommenen Selbstbindung Gottes an das Geschöpfliche spricht (finitum capax infiniti), finden wir bei Calvin die Freiheit Gottes betont: Zu seiner Gottheit gehört es, sich den Bedingungen der Endlichkeit zu entziehen.
Der Mensch hingegen soll seine irdische Verfasstheit annehmen und akzeptieren: „Warum den Flug in die Luft nehmen und den festen Boden verlassen, der doch der Schauplatz der Güte Gottes ist? ... Es muss der Fuß fest auf der Erde stehen, ist sie doch die Stätte, auf der wir nach Gottes Anordnung eine Zeitlang weilen.“[4] Was auf Erden geschaffen ist, steht aber unter dem Vorzeichen des Unendlichen, von dem her alles Leben sein Recht bekommt. Dieses kritische Potential sorgte dafür, dass auf Seiten der Reformierten eine Abneigung dagegen entstand, natürliche Vorgänge in der Welt als Schöpfungsordnungen hochzustilisieren. Calvins Schöpfungsvorstellung hat damit eminente politisch-ethische Konsequenzen, da hier die Überzeugung wurzelt, dass sich das Vorletzte vor dem Letzten verantworten muss.
Es ist interessant zu sehen, an welcher Stelle Calvin Jesus Christus in die Auslegung der Schöpfungspsalmen einführt. Angesichts der Tatsache, dass der Mensch die gute Ordnung Gottes verwirrt hat, bedarf es ihrer Wiederherstellung. Diese geschieht bei der Wiederkunft Christi, der endzeitlich dafür sorgen wird, dass alles wieder vollkommen in Ordnung kommt (Ps. 72,2). Die Kirche als Leib Christi ist der Ort, an dem sich schon jetzt Spuren der wiederhergestellten Schöpfung abzeichnen – dies gesagt als Trost für die, die das Leben um sie herum als chaotisch erleben (Ps. 102,26). Nicht zuletzt darum liegt Calvin soviel daran, dass die Kirche ihre Ordnung hat und gleichsam in guter Ordnung ist. Oder mit der 3. Barmer These gesagt: Die Kirche bezeugt mit ihrer Botschaft und mit ihrer Ordnung, dass sie Kirche der begnadigten Sünder ist und von Christi Trost her lebt.
2.3. Gott als der gerechte Richter
In den Psalmen wird auch über Recht und Gerechtigkeit, Zorn und Strafe geredet. Immer wieder rufen die Psalmisten Gott auf, als Richter aufzutreten und Unrecht zu bestrafen. Wie geht Calvin mit diesen dunklen Seiten Gottes um? Calvin blendet diese Texte nicht aus, sondern zeichnet Gott so als Richter, dass er wohl Respekt einflößt, aber keine Angst einjagt.
Er versteht die Gerechtigkeit Gottes primär als Treue und Barmherzigkeit, mit der er die Gläubigen beschützt (Ps. 5,9; 7,18): Gottes Gerechtigkeit „ist sein fortwährender Schutz, mit dem er über die Seinen wacht, und die Güte, mit der er sie hegt“ (Ps. 40,11). Wie Luther geht es Calvin um die Gerechtigkeit, die Gott schenkt und – hier liegt der besondere Akzent Calvins – mit der er seine Bundestreue beweist. Die Gerechtigkeit Gottes vergilt nicht jedem nach dem, was ihm zukommt, „sondern ist ein Beweis seiner Güte, Gnade und Treue“ (Ps. 98,1). Allerdings fordert Gott von Seiten des Menschen eine entsprechende Gerechtigkeit und mahnt insbesondere die soziale Gerechtigkeit gegenüber Witwen, Waisen und Flüchtlingen an (Ps. 94,5). Gerade die Kinder, die besonders verletzlich und schutzbedürftig sind, bedürfen der Fürsorge gegen alles Böse, da Unrecht gegen Wehrlose Gottes Zorn weckt (Ps. 94,5).
Gottes Gerechtigkeit und der Anspruch an die Menschen, füreinander einzutreten, hat allerdings eine Kehrseite: seine strafende Gerechtigkeit gegenüber den Feinden Israel und der christlichen Gemeinde (Ps. 5,5). Dieses Urteil Gottes über die Feinde ist der Ausdruck seiner Liebe zu den Gläubigen (Ps. 74,3): „Kein Wunder also, wenn die Gottlosen aus ihrem erträumten Glück plötzlich herausgerissen werden!“ Denn: „Jedes Mal, wenn sie über ihr Leben Rechenschaft geben müssen, erkennen sie, wie vom Schlaf erwacht, dass es nur ein Traum gewesen ist, als sie sich – kaum recht bei Besinnung – für glücklich hielten.“ (Ps. 1,5).
Sollte es den Menschen allerdings gelingen, Gott vom Thron zu holen und ihm das Amt des Richters zu nehmen, dann hätten Gottlosigkeit und Unmenschlichkeit ihren Höhepunkt erreicht. Die Botschaft Calvins ist deutlich: Eine Gottesrede, in der Gott kein über alles regierender König und kein strafender Richter wäre, wäre keine Gottesrede und würde auch die Unmenschlichkeit befördern. Calvin will Gott keineswegs auf die Gestalt des Richters festlegen. Aber er will beim Sünder das Verlangen wecken, bei Gott Zuflucht zu suchen (Ps. 19,12) und ihn um Vergebung zu bitten (Ps. 25,18).
Gottes Strafe ist eine väterliche, und wenn er straft, lässt er darin immer seine Gnade und Liebe fühlen: „Er mäßigt die Strafe nicht nur, sondern indem er die Strafe mit Trost würzt, macht er sie selbst angenehm.“ (Ps. 39,11). Strafe gegenüber den Gläubigen ist Strafe auf Zeit und mit dem Ziel der Freude (Ps. 85,6). Im Hintergrund steht der calvinische Gedanke der göttlichen Pädagogik, durch die Gott die Menschen dazu anhält, ihr Leben zu bessern.
Schließlich wagt sich Calvin auch in die Region von Gottes Zorn vor. Die Rede von Gottes Zorn ist aber ein uneigentliches Reden, weil sein Zorn immer mit Gnade vermischt ist (Ps. 6,2). Selbst wenn er zürnt, hört er nicht auf, Vater zu sein (Ps. 74,9). Von Gott wird etwas ausgesagt, was faktisch nicht auf ihn zutrifft: Denn Zorn drückt emotionale Erregung aus – eine Eigenschaft, die eigentlich nicht zu Gott passt (Ps. 74,1). In seinem Zorn setzt sich Gott gleichsam eine Maske auf, damit wir seinen Widerwillen gegen die Sünde merken (Ps. 106,23).
2.4. Gott als der liebende Vater
Öfter als über Gottes Zorn spricht Calvin von Gott als liebendem Vater. Seine Gottesaussagen münden immer wieder in die Erklärung, dass die Vaterschaft Gottes das endgültige Ziel seines Handelns ist und sich das Leben im Glauben als eine Vater-Kind-Beziehung darstellt. Die Gewissheit des Glaubens wächst, wo Gott wie ein Vater für seine Kinder sorgt. Weniger die subjektive Frage, ob jemand ein Kind Gottes ist, interessiert ihn, sondern die grundsätzliche Frage, ob Gott angesichts des Schreckens und Elends in der Welt für den einzelnen Menschen Sorge trägt.
Glaubensgewissheit bedeutet, „geduldig auf Gnade zu warten, wenn sie auch verborgen ist, und sich an sein Wort zu hängen, wenn es auch so lange dauert, bevor etwas von diesem Wort zu bemerken ist“ (Ps. 52,11). Und an anderer Stelle heißt es: Der Glaube weiß den Himmel mit der Erde zu verbinden, so dass wir „in all den Schiffbrüchen, die uns treffen, den Anker unseres Glaubens und unserer Gebete in den Himmel auswerfen“ (Ps. 88,7).
Diese Gewissheit wandelt sich in Freude an Gott. Die Freude ist nach Calvin ein wesentlicher Bestandteil des Glaubens und geradezu gleichbedeutend mit ihm (Ps. 51,9): „Obwohl wir nicht immun gegen Schmerz sind, ist es doch nötig, dass die Freude des Glaubens darüber hinaussteigt, die uns zum Singen über die zukünftige Freude bringt.“ (Ps. 13,6). Solche Freude an Gott inmitten des Unglücks zu empfinden: das ist die Botschaft Calvins für die Asylsuchenden in Genf und für die Verfolgten in Frankreich. Wiederum wird das Bewusstsein Calvins dafür deutlich, dass die Psalmen Orte und Zeiten überwinden, um in der eigenen Gegenwart das Ihre zu sagen – theologisch und existenziell.
3. Die Psalmen und Jesus Christus
Calvin geht in seiner Psalmenauslegung von einer wichtigen Voraussetzung aus, nämlich der Einheit zwischen Altem und Neuem Testament. Die ganze Bibel bezeugt den einen Gnadenbund, so dass auch im Alten Testament und besonders in den Psalmen Gottes Gnade und Treue begegnen. Zugleich gibt es in der Bibel eine fortschreitende Bundesgeschichte, wobei der Unterschied zwischen der Zeit vor und nach dem Erscheinen Christi eher graduell ist: „Christus war zwar schon den Juden unter dem Gesetz bekannt; er tritt uns aber erst im Evangelium entgegen.“ (Institutio II,9,1).
Die Einheit des Gottesbundes wird so stark betont, dass das Erscheinen Christi lediglich die Erneuerung der Zeiten ist (Ps. 48,8). Für das Verständnis der Kirche entscheidend ist die Auskunft, dass das Erscheinen Christi keineswegs der Anfang der Kirche ist, sondern lediglich der Beginn einer neuen Epoche in der Kirche (Ps. 96,7). Calvin sieht die Kirche zutiefst im Bund Gottes mit Israel verwurzelt, und die Psalmen sind ihm ein elementares Zeugnis für diesen Sachverhalt.
Vom Grundsatz der Einheit des Gottesbundes aus kommt Calvin dann allerdings auch zur Unterscheidung des Reiches Davids und des Reiches Christi (Ps. 21,4), wobei gilt: „Das Königreich Christi beginnt bei dem Königreich Davids, denn bei David wird das Fundament für Christus gelegt.“ (Ps. 118,25). Calvin folgt der altkirchlichen Tradition, die Psalmen auf Jesus Christus zu beziehen. So finden wir immer wieder die Auskunft, dass Christus das Ziel der Verheißungen der Psalmen ist.
Calvins Bezugnahmen auf Christus sind vielfältig. Zunächst liegt ihm daran, dass auch die Gemeinde, die Christus als ihren Herrn bekennt, allen Anlass hat, auf die Worte der Psalmen zu hören: „Auch wir, deren Leben mit Christus in Gott verborgen ist, müssen unser ganzes Leben hindurch dieses alte Lied bedenken.“ (Ps. 118,17). Der Bezug der Psalmen auf Christus ist auch dadurch gegeben, dass David Christus bereits bildhaft in sich trug, da Israel unter ihm und seinen Nachfolgern bis zum Erscheinen Christi lebte.
Der irdische Thron Davids stellt sich für Calvin als Abbild der ewigen Herrschaft Christi dar. Was in den Psalmen über das Königreich David gesagt wird, „trifft eigentlich [erst] auf die Person Christi zu, und alles, was dunkel und schattenhaft in David angedeutet war, ist vollständig [erst] in Christus zu Tage getreten“ (Ps. 118,26). Calvin bedient sich der Typologie und verdichtet diese durch den Hinweis, dass Gottes Gnade im Alten Bund „das Vorspiel der Erlösung“ gewesen sei, „die man endlich von Christus erhoffen durfte“ (Ps. 118,27).
Die Grundlinien, die Calvin zieht, zeigen eine Theologie, die die besondere Stellung Israels wahrnimmt. Calvin wirbt geradezu dafür, Gottes Hinwendung zum Volk seines Bundes wahrzunehmen, und spricht von einer auf Gottes Gnade beruhenden „heiligen Verbindung“ mit Israel (Ps. 24,1). Auch die Verwendung des Begriffs „ecclesia“ für Israel ist ein deutliches Indiz für die Zusammengehörigkeit von Synagoge und Kirche. Er liest die Aussagen der Psalmen über Gottes Volk als Aussagen über die Kirche, ohne dabei den Bezug der Psalmen auf Israel aufzulösen. Jesus Christus ist nicht nur der Erlöser, sondern auch das Bindeglied zwischen Israel und der Kirche (Ps. 45,17).
Israeltheologisch bedeutsam ist schließlich Calvins Überzeugung, dass die Juden mit der Ankunft des Evangeliums keineswegs außerhalb des Gottesbundes gestellt sind, sondern umgekehrt Menschen aus den Völkern dem Bund hinzugefügt und aus Gottes Gnade in das Haus Abrahams aufgenommen wurden (Ps. 47,10; 110,2; 98,3). Die Juden sind die Quelle, aus der heraus Gott die ganze Erde befeuchtet (Ps. 97,8). Und selbst wenn die Juden Christus als Erlöser ablehnen, behält Israel seine herausragende Stellung (Ps. 47,10). Die Kirche ist folglich nicht an die Stelle Israels getreten, sondern die Gläubigen unter den Völkern werden in Gottes Bund mit Israel aufgenommen, um mit ihnen gemeinsam Gott zu loben (Ps. 150,5).
4. Verbindliches Reden von Gott
Die Einblicke in die Gottesrede, die Calvin in den Psalmen erkennt, können auch uns als Anleitung dienen, von Gott verbindlich zu reden. Calvins Ringen mit den Psalmen kann sich auch für unsere Gottesrede – insbesondere die der Predigt – als inspirierend auswirken. Denn die Schwierigkeiten, angemessen von Gott zu reden, sind offenkundig: Selbst da, wo sich die Predigt als Anwältin des biblischen Textes erweist, entsteht doch von Zeit zu Zeit die Verlegenheit, wie man dem Beziehungsreichtum Gottes auch sprachlich nachkommen kann statt monoton und steril die Vokabel Gott im Mund zu führen.
Inspiration tut Not: biblische Inspiration von der Buntheit der Gottesbezeichnungen, die nicht zuletzt in den Psalmen wahrzunehmen sind. Calvin hat sich der Vielfalt der Gottesbezeichnungen gestellt und diese nicht auf Gott als Menschenfreund begrenzt. So weiß er von der Freiheit Gottes und seiner Andersartigkeit. Er spricht vom Schöpfer des Kosmos und seiner Fürsorge für den Menschen. Er stellt sich dem richtenden und sein Recht ausübenden Gott. Er tastet sich in die Bereiche der Verborgenheit und des Zorns Gottes vor. Er weiß von ihm als dem Heiligen zu reden und sieht ihn zugleich in seiner Bundesgemeinschaft mit den Menschen. Es ist gerade die bunte Vielfalt in der Einheit Gottes, die Calvin in den Psalmen entdeckt und der er sich stellt. Er tritt dafür ein, dass das genaue Hören auf die biblischen Texte der menschlichen Gottesrede zur Sprache verhilft.
Wer unter Anleitung Calvins von Gott redet, bringt ihn zugleich als den zur Sprache, der im Bund mit den Menschen für diese heilsam gegenwärtig ist. Gott erweist sich als ein Gott in Beziehungen, so dass konsequent auch das Reden von Gott diesen nicht einfach als „höchstes Gut“ anspricht, sondern als den, der redet und handelt. Wer unter dieser Voraussetzung von Gott redet, bringt dann auch die eigene Person in ihren Regungen und Empfindungen ins Spiel und versteht sich selbst als von Gott angesprochenes Wesen. Eine solche Lesekunst, wie sie bei Calvin erkennbar ist, kann das eigene Leben in die Schrift gleichsam einzeichnen, um in der Gegenwart Israels von dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der zugleich der Vater Jesu Christi ist, zu reden.
Im Gespräch mit Calvins Psalmenauslegung wird auch uns die Aufgabe zugemutet, das Wagnis einzugehen, in den Grenzen menschlicher Worte von Gott zu reden. Nur unter der Voraussetzung, dass Gott selbst zum Menschen redet, kann eine solche Gottesrede gewagt werden. Wenn diese dem Schweigen und dem Geschwätz vorgezogen und gewagt wird, dann wird diese Gottesrede verbindlich sein. Auf diesen Weg weist uns auch die 6. Barmer These, die den Auftrag der Kirche anmahnt, „die Botschaft von der freien Gnade Gottes auszurichten an alles Volk“.
Die verbindliche Rede von Gott muss seiner Personalität entsprechen. Statt einer göttlichen Kraft, wie es gelegentlich heißt, eignet Gott die Anrede als Person und mit Namen, was ein gemeinsames Anliegen der jüdischen und der christlichen Gottesrede ist. Der Aufruf „Allein Gott die Ehre“ entfaltet sein ideologiekritisches Potenzial bis heute: Wer Gott allein die Ehre gibt, wird alles Geschaffene achten, nicht aber verehren, und dem Menschen als Geschöpf Gottes seine Würde zusprechen. Wo Gott die Ehre zukommt, kann auch der Mensch menschlich leben.
5. Zu Gott reden im Gebet und Psalmengesang
Die Aufgabe der christlichen Gemeinde, verkündigend und bekennend von Gott zu reden, schließt die Aufgabe in sich, zu Gott zu reden. Darauf zielt ja überhaupt alle Theologie: auf die Anrufung Gottes im Gebet. Nach Calvin ist das Gebet der Hauptort des Gesprächs von Mensch und Gott. Ohne das Gebet würde der Glaube leblos werden (Ps 119,58). „Familiär“, so wie ein Kind mit seinen Eltern spricht, ist der Umgang der Bundespartner Mensch und Gott im Gebet (vgl. Ps 10,13). Es ist ein unvorstellbares Vorrecht, dass sich der Mensch frei an Gott wenden darf (Ps 65,2; 50,14; 145,18).
Nicht zu beten hieße, Gott die Ehre zu entziehen, weil man seine Hilfe ignorierte (Ps 17,1). So wird das Reden zu Gott im Gebet gleichsam zur Sehhilfe des Glaubens. Eng verwandt mit Calvins Hochschätzung des Gebetes sind seine Initiativen für die Gestaltung des reformierten Gottesdienstes, insbesondere bei der Einführung des Psalmengesangs. Wie schon beim Gebet sollte sich auch im Psalmengesang zeigen, dass das rechte Reden von Gott eine Anleitung zur Anrufung Gottes ist. In den Artikeln zur Ordnung der Kirche von 1537 schreibt Calvin: „Weiter ist es zum Aufbau der Kirche eine überaus nützliche Sache, einige Psalmen als öffentliche Gebete zu singen, und so Bitten an Gott zu richten, oder ihn singend zu loben.“[5]
Die Psalmen sollen nach der Genfer Gottesdienstordnung von 1542 als „ehrbare Lieder, welche die Liebe und Ehrfurcht gegenüber Gott lehren“ gesungen werden. Und: „Wir werden keine besseren und geeigneteren Lieder finden als die Psalmen Davids (...) Wenn wir sie singen, so sind wir sicher, dass Gott uns die Worte in den Mund legt, als ob er selbst in uns sänge, um seine Ehre zu erhöhen.“[6] Am Ende dieses liturgisch innovativen Weges steht der französische Hugenottenpsalter bzw. Genfer Psalter von 1562 mit der Bereimung und Vertonung sämtlicher 150 Psalmen. Diese Vertonung unterstreicht Calvins Leidenschaft dafür, dass zur Rede von Gott die Rede zu Gott hinzutritt.
[1] Die Auslegung trägt den lateinischen Titel „In librum Psalmorum, Iohannis Calvini Commentarius“ und findet sich in Calvini opera (CO), Bände 31 und 32. Eine lateinisch-deutsche Auswahledition der Psalmenauslegung wird im Rahmen der Calvin-Studienausgabe derzeit erarbeitet und erscheint 2008. Als ältere Übersetzung liegt vor: Johannes Calvins Auslegung der Heiligen Schrift, Bd. 4/1 und 4/2: Die Psalmen, Neukirchen o.J. (1914).
[2] Herman J. Selderhuis, Gott in der Mitte. Calvins Theologie der Psalmen, Leipzig 2004, 19f. Auch im Folgenden verdankt der Autor dieser Monographie wichtige Einsichten in Calvins Psalmenauslegung.
[3] Elie Wiesel, Eines Menschen Gebet, in: ders., Macht Gebete aus meinen Geschichten, Freiburg i.Br. 1986, 39.
[4] Auslegung zu Gen 2,8, in: CO 23,37; vgl. J. Calvin, De aeterna praedestinatione dei: „theatrum gloriae dei, in: CO 8,294.
[5] Artikel zur Ordnung der Kirche (1537), in: Calvin-Studienausgabe, hg. v. E. Busch u.a., Bd. 1.1, Neukirchen-Vluyn 1994, 115.
[6] Genfer Gottesdienstordnung (1542), in: Calvin-Studienausgabe, hg. v. E. Busch u.a., Bd. 2, Neukirchen-Vluyn 1997, 159.
Matthias Freudenberg
Matthias Freudenberg, Johannes Calvin als Ausleger der Psalmen. PDF